Das Herzenhören / Die Burma-Serie Bd.1
Roman
Eine der großen Liebesgeschichten unserer Zeit, die schon Hunderttausende Leserinnen begeisterte und stetig neue Leser findet: Die Suche nach ihrem vermissten Vater führt Julia Win von New York nach Kalaw, einem malerischen, in den Bergen Burmas...
lieferbar
versandkostenfrei
Taschenbuch
12.00 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Das Herzenhören / Die Burma-Serie Bd.1 “
Eine der großen Liebesgeschichten unserer Zeit, die schon Hunderttausende Leserinnen begeisterte und stetig neue Leser findet: Die Suche nach ihrem vermissten Vater führt Julia Win von New York nach Kalaw, einem malerischen, in den Bergen Burmas versteckten Dorf. Ein vierzig Jahre alter Liebesbrief ihres Vaters an eine unbekannte Frau hat sie an diesen magischen Ort geführt. Hier findet sie nicht nur einen Bruder, von dem sie nichts wusste, sondern stößt auch auf ein Familiengeheimnis, das ihr Leben für immer verändert.
Klappentext zu „Das Herzenhören / Die Burma-Serie Bd.1 “
Eine der großen Liebesgeschichten unserer Zeit, die schon Hunderttausende Leserinnen begeisterte und stetig neue Leser findet: Die Suche nach ihrem vermissten Vater führt Julia Win von New York nach Kalaw, einem malerischen, in den Bergen Burmas versteckten Dorf. Ein vierzig Jahre alter Liebesbrief ihres Vaters an eine unbekannte Frau hat sie an diesen magischen Ort geführt. Hier findet sie nicht nur einen Bruder, von dem sie nichts wusste, sondern stößt auch auf ein Familiengeheimnis, das ihr Leben für immer verändert.
Lese-Probe zu „Das Herzenhören / Die Burma-Serie Bd.1 “
Das Herzenhören von Jan-Philipp SendkerERSTER TEIL
1
Seine Augen waren mir als Erstes aufgefallen. Sie lagen tief in ihren Höhlen, und es war, als könne er den Blick nicht von mir lassen. Alle Gäste des Teehauses starrten mich mehr oder weniger unverhohlen an, aber er war der aufdringlichste. Als wäre ich ein exotisches Wesen, eines, das er zum ersten Mal sieht. Sein Alter konnte ich schlecht schätzen. Sein Gesicht war voller Falten, sechzig war er mit Sicherheit, vielleicht schon siebzig. Er trug ein vergilbtes weißes Hemd, einen grünen Longy und Gummisandalen. Ich versuchte ihn zu ignorieren und blickte mich im Teehaus um, einer Bretterbude mit ein paar Tischen und Hockern, die auf der trockenen, staubigen Erde standen. An einer Wand hingen alte Kalenderblätter, die junge Frauen zeigten. Ihre Gewänder reichten bis auf den Boden, und mit ihren langärmeligen Blusen, den hochgeschlossenen Kragen und ihren ernsten Gesichtern erinnerten sie mich an alte, handcolorierte Fotos von Töchtern aus gutem Hause um die Jahrhundertwende, wie man sie auf Flohmärkten in New York finden konnte. An der Wand gegenüber befand sich eine Vitrine mit Keksen und Reiskuchen, auf denen sich Dutzende von Fliegen niedergelassen hatten. Daneben stand ein Gaskocher mit einem verrußten Kessel, in dem das Wasser für den Tee kochte. In einer Ecke stapelten sich Holzkisten mit orangefarbener Limonade. Ich hatte noch nie in einer so erbärmlichen Hütte gesessen.
Es war brütend heiß, der Schweiß lief mir die Schläfen und den Hals hinab, meine Jeans klebte auf der Haut. Plötzlich stand der Alte auf und kam auf mich zu.
... mehr
»Entschuldigen Sie vielmals, junge Frau, dass ich Sie so einfach anspreche«, sagte er und setzte sich zu mir. »Es ist sehr unhöflich, ich weiß, zumal wir uns nicht kennen oder zumindest Sie mich nicht kennen, nicht einmal flüchtig. Ich heiße U Ba und habe schon viel von Ihnen gehört, was aber mein Verhalten, ich gebe es zu, auch nicht höflicher macht. Ich vermute, es ist Ihnen unangenehm, in einem Teehaus, an einem fremden Ort, in einem fremden Land von einem Ihnen unbekannten Mann angesprochen zu werden, und ich habe dafür mehr als Verständnis, aber ich möchte, oder sollte ich ehrlicher sein und sagen, ich muss Sie etwas fragen. Ich habe auf diese Gelegenheit zu lange gewartet, als dass ich nun, da Sie da sind, schweigend vor Ihnen sitzen könnte.
Vier Jahre habe ich gewartet, um genau zu sein, und oft bin ich am Nachmittag auf und ab gegangen, dort, an der staubigen Hauptstraße, wo der Bus ankommt, der die wenigen Touristen bringt, die sich in unseren Ort verirren. Manchmal, wenn sich die Gelegenheit ergab, bin ich an den seltenen Tagen, an denen eine Maschine aus der Hauptstadt landet, zu unserem kleinen Flughafen gefahren und habe, vergeblich, Ausschau nach Ihnen gehalten.
Sie haben sich Zeit gelassen.
Nicht, dass ich Ihnen das vorwerfen möchte, bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich bin ein älterer Mann, der nicht weiß, wie viele Jahre ihm noch gegeben sind. In unserem Land altern die Menschen schnell und sterben früh. Mein Leben neigt sich langsam, und ich habe noch eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die für Sie bestimmt ist.
Sie lächeln. Sie halten mich für übergeschnappt, für ein wenig verrückt oder zumindest sehr verschroben? Dazu haben Sie jedes Recht. Nur bitte, bitte, wenden Sie sich nicht ab. Das alles mag rätselhaft und sonderbar für Sie klingen, und ich gestehe ein, dass mein Äußeres nicht dazu angetan ist, Ihr Vertrauen zu erwecken. Ich wünschte, ich hätte strahlend weiße Zähne wie Sie und nicht diese braunen Stummel im Mund, die nicht einmal mehr zum Kauen richtig taugen, diese Trümmer eines Gebisses. Meine Haut ist welk und schlaff und hängt von meinen Armen, als hätte ich sie dort zum Trocknen abgelegt. Man sagt, ich stinke aus dem Mund, meine Füße sind schmutzig und zerschunden vom jahrzehntelangen Laufen in billigen Sandalen, mein Hemd, das einmal weiß war, hätte eigentlich schon vor Jahren in den Müll gehört. Glauben Sie mir, ich bin ein reinlicher Mensch, aber Sie sehen, in welchem Zustand sich unser Land befindet. Beschämend. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, aber ich kann es nicht ändern, und es hat mich viele Jahre meines Lebens gekostet zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Lassen Sie sich nicht von meiner äußeren Erscheinung in die Irre führen. Verwechseln Sie meinen Gleichmut nicht mit Desinteresse oder Resignation. Nichts läge mir ferner, meine Liebe.
Ich schweife ab, und ich sehe in Ihren Augen, dass ich Ihre Geduld strapaziere. Bitte, sehen Sie es mir nach, und wenden Sie sich nicht ab. Es wartet doch niemand auf Sie, habe ich Recht? Sie sind allein gekommen, so wie ich es erwartet hatte. Geben Sie mir ein paar Minuten Ihrer Zeit. Bleiben Sie noch etwas bei mir, Julia.
Sie staunen? Ihre wunderschönen braunen Augen werden noch größer, und zum ersten Mal schauen Sie mich wirklich an. Sie sind erschrocken. Sie fragen sich, woher ich Ihren Namen weiß, da wir uns doch noch nie gesehen haben und Sie zum ersten Mal in unserem Land zu Gast sind? Kann es Zufall sein? Sie überlegen, ob ich vielleicht irgendwo ein Schild mit Ihrem Namen an Ihrer Jacke oder Ihrem kleinen Rucksack gesehen habe? Nein, habe ich nicht, glauben Sie mir. Ich kenne Ihren Namen, so wie ich den Tag und die Stunde Ihrer Geburt kenne, ich weiß um die kleine Jule, die nichts mehr liebte, als von Ihrem Vater Geschichten erzählt zu bekommen, und ich könnte Ihnen hier und jetzt Jules Lieblingsmärchen erzählen. Die Geschichte vom Prinzen, der Prinzessin und dem Krokodil.
Julia Win. Geboren am 28. August 1968 in New York City. Mutter Amerikanerin. Vater Birmane. Ihr Familienname ist Teil meiner Geschichte, Teil meines Lebens, seit ich vor fünfundfünfzig Jahren aus dem Schoß meiner Mutter kroch, und in den vergangenen vier Jahren gab es keinen Tag, an dem ich nicht an Sie gedacht hätte. Ich werde Ihnen alles später erklären, aber lassen Sie mich zuerst meine Frage stellen: Glauben Sie an die Liebe?
Sie lachen. Wie schön Sie sind. Ich meine es ernst. Glauben Sie an die Liebe, Julia?
Selbstverständlich spreche ich nicht von dem Ausbruch an Leidenschaft von dem wir meinen, er wird unser Leben lang nicht enden, der uns Dinge tun und sagen lässt, die wir später bereuen, der uns glauben machen will, dass wir ohne einen bestimmten Menschen nicht leben können, der uns vor Angst erzittern lässt bei dem Gedanken, wir könnten diesen Menschen wieder verlieren. Dieses Gefühl, das uns ärmer und nicht reicher macht, weil wir besitzen wollen, was wir nicht besitzen können, weil wir festhalten wollen, was wir nicht festhalten können. Ich meine auch nicht die körperliche Begierde und nicht die Eigenliebe, diesen Parasiten, der sich so gern als selbstlose Liebe tarnt.
Ich spreche von der Liebe, die Blinde zu Sehenden macht. Von der Liebe, die stärker ist als die Angst. Ich spreche von der Liebe, die dem Leben einen Sinn einhaucht, die nicht den Gesetzen des Verfalls gehorcht, die uns wachsen lässt und keine Grenzen kennt. Ich spreche vom Triumph des Menschen über die Eigensucht und den Tod.
Sie schütteln den Kopf? Daran glauben Sie nicht? Oh, Sie wissen gar nicht, wovon ich spreche? Das überrascht mich nicht, mir erging es ähnlich, bevor ich Ihren Vater traf. Warten Sie ab, Sie werden verstehen, was ich meine, sobald ich Ihnen die Geschichte erzählt habe, die ich seit vier Jahren für Sie mit mir herumtrage. Nur um ein wenig Geduld muss ich Sie bitten. Es ist spät geworden, und Sie sind sicherlich müde von der langen Reise. Ich für meinen Teil muss mit meinen Kräften haushalten und bitte um Ihr Verständnis, wenn ich mich jetzt zurückziehe. Wenn es Ihnen genehm ist, sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit an diesem Tisch in diesem Teehaus wieder. Hier traf ich, wenn ich das noch erwähnen darf, Ihren Vater, und um ganz ehrlich zu sein, dort, auf Ihrem Schemel hockte er und begann zu erzählen, und ich saß hier, auf diesem Platz, staunend, ja, ich gebe zu, ungläubig und verwirrt. Ich hatte noch nie einen Menschen so erzählen hören. Können Worte Flügel haben? Können sie wie Schmetterlinge durch die Luft gleiten? Können sie uns mitreißen, davontragen in eine andere Welt? Können sie uns erbeben lassen wie die Naturgewalten, die die Erde erschüttern? Können sie die letzten geheimen Kammern unserer Seele öffnen? Ich weiß nicht, ob Worte allein es vermögen, aber zusammen mit der menschlichen Stimme können sie es, Julia, und Ihr Vater hatte an diesem Tag eine Stimme, wie wir sie vielleicht nur einmal im Leben haben. Er erzählte nicht, er sang, und obwohl er flüsterte, gab es in diesem Teehaus keinen Menschen, dem nicht die Tränen kamen, allein vom Klang seiner Stimme. Aus seinen Sätzen wurde bald eine Geschichte und aus der Geschichte ein Leben, das seine Kraft entfaltete und seine Magie. Was ich hörte, machte mich zu einem Gläubigen, wie Ihren Vater.
›Ich bin kein religiöser Mensch, und die Liebe, U Ba, die Liebe ist die einzige Kraft, an die ich wirklich glaube.‹ Das sind die Worte Ihres Vaters.«
U Ba schaute mich an und erhob sich. Er legte die Hände vor der Brust aneinander, ohne sie zu falten, machte die Andeutung einer Verneigung und verließ mit ein paar schnellen, leichtfüßigen Schritten das Teehaus.
Ich blickte ihm nach, bis er im Gewühl der Straße verschwunden war.
Nein, wollte ich ihm hinterherrufen, nein, ich glaube an keine Kraft, die Blinde zu Sehenden macht. Ich glaube nicht an Wunder und nicht an Magie. Das Leben ist kurz, zu kurz, um Zeit mit solchen Hoffnungen zu verschwenden. Ich genieße es, wie es ist, anstatt mir Illusionen zu machen. Ob ich an die Liebe glaube? Was für eine Frage. Als wäre die Liebe eine Religion, an die man glaubt oder nicht. Als Achtzehnjährige habe ich von dem Prinzen geträumt, der kommt und mich rettet und befreit, und als er kam, musste ich lernen, dass es Prinzen nur im Märchen gibt, und dass die Liebe blind macht und nicht sehend. Nein, wollte ich dem Alten hinterherrufen, ich glaube an keine Kraft, die stärker ist als die Angst, ich glaube nicht an einen Triumph über den Tod. Nein. Nein.
Stattdessen hockte ich auf meinem Hocker, zusammengesunken und eingefallen. Ich hörte noch immer seine Stimme, sie war weich und melodisch, in ihrer Sanftheit der meines Vaters nicht unähnlich. Seine Worte hallten in meinem Kopf wie ein Echo, das keine Ende nehmen will.
Bleiben Sie noch etwas bei mir, Julia, Julia, Julia...
Glauben Sie an die Liebe, an die Liebe...
Die Worte Ihres Vaters, Ihres Vaters...
Ich hatte Kopfschmerzen und fühlte mich erschöpft. Als wäre ich aus einem Albtraum erwacht, der nicht aufhörte, mich zu quälen. Um mich herum summten Fliegen, setzten sich auf meine Haare, meine Stirn und meine Hände. Mir fehlte die Kraft, sie zu verscheuchen. Vor mir lagen drei trockene Kekse, auf dem Tisch klebte brauner Zucker.
Ich wollte einen Schluck von meinem Tee trinken. Er war kalt, und meine Hand zitterte. Die Finger umklammerten das Glas, es glitt mir aus der Hand, langsam, wie in Zeitlupe konnte ich sehen, dass es rutschte, so kräftig ich auch drückte. Das Geräusch des zersplitternden Glases auf dem Fußboden. Die Blicke der anderen Gäste. Als hätte ich eine Schrankwand mit Gläsern umgestoßen. Warum hatte ich diesem Fremden so lange zugehört? Ich hätte ihn bitten können zu schweigen. Ich hätte ihm klar und unmissverständlich sagen müssen, er solle mich in Ruhe lassen. Ich hätte aufstehen können. Irgendetwas hielt mich. Ich hatte mich abwenden wollen, da sagte er: Julia, Julia Win. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass ich bei der Erwähnung meines Namens je so erschrecken würde. Mein Herz raste.Woher wusste er meinen Namen? Was wusste er noch von mir? Kannte er meinen Vater? Wann hatte er ihn zuletzt gesehen? Weiß er womöglich, ob mein Vater noch am Leben ist, wo er steckt?
2
Der Kellner wollte mein Geld nicht.
»Sie sind eine Freundin von U Ba. Seine Freunde sind unsere Gäste«, sagte er und verneigte sich.
Ich holte dennoch einen Geldschein aus meiner Hosentasche. Er war dreckig und abgegriffen, ich ekelte mich und schob ihn unter den Teller mit den Keksen. Der Kellner räumte das Geschirr ab, ohne den Schein zu berühren. Ich deutete auf das Geld, er lächelte nur.
War es ihm zu wenig, zu schmutzig oder nicht gut genug? Ich legte eine größere und saubere Note auf den Tisch. Er verbeugte sich, lächelte wieder und rührte sie nicht an.
Draußen war es noch heißer. Die Hitze lähmte mich, ich stand vor dem Teehaus, unfähig einen Schritt zu tun. Die Sonne brannte auf meiner Haut, und das grelle Licht stach in den Augen. Ich setzte meine Baseballmütze auf und zog sie tief ins Gesicht.
Die Straße war voller Menschen, gleichzeitig herrschte eine seltsame Stille. Irgendetwas fehlte, und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was es war. Es gab kaum motorisierte Fahrzeuge. Die Menschen gingen zu Fuß oder waren mit dem Fahrrad unterwegs. An einer Kreuzung parkten drei Pferdekutschen und ein Ochsenkarren. Die wenigen Autos, die es zu sehen gab, waren alte japanische Pick-up Trucks, zerbeult und verrostet, voll beladen mit großen Bastkörben und Säcken, an denen sich junge Männer festgeklammert hielten.
Die Straße war gesäumt von flachen, einstöckigen Holzbuden mit Wellblechdächern, wie ich sie aus dem Fernsehen von Slums in Afrika oder Südamerika kannte. Es waren Geschäfte, Kaufhäuser auf zehn Quadratmetern, die alles anboten von Reis, Erdnüssen, Mehl und Haarshampoo bis zu Coca Cola und Bier. Die Ware lag wild durcheinander, es gab keine Ordnung oder aber eine, die mir fremd war.
Jeder zweite Laden schien ein Teehaus zu sein, die Gäste hockten auf kleinen Holzschemeln davor. Um den Kopf hatten sie sich rote und grüne Frotteehandtücher gewickelt, ein Kopfschmuck, der ihnen so selbstverständlich war, wie mir meine dunkelblaue New-York-Yankee-Baseballmütze. Anstelle von Hosen trugen die Männer Gewänder, die wie Wickelröcke aussahen, und sie rauchten lange dunkelgrüne Zigarillos.
Vor mir standen ein paar Frauen. Sie hatten sich gelbe Paste auf Wangen, Stirn und Nase geschmiert und sahen aus wie Indianerinnen auf dem Kriegspfad, und jede paffte einen dieser stinkenden grünen Stummel.
Ich überragte sie alle um mindestens einen Kopf, auch die Männer. Sie waren schlank, ohne dabei hager zu wirken, und sie bewegten sich mit der Eleganz und Leichtigkeit, die ich an meinem Vater immer bewundert hatte. Dagegen fühlte ich mich fett und schwerfällig mit meinen sechzig Kilo und meiner Größe von 1,76.
Am schlimmsten waren ihre Blicke.
Sie wichen mir nicht aus, sie schauten mir direkt ins Gesicht und in die Augen und lächelten. Es war kein Lächeln, das ich kannte.
Wie bedrohlich ein Lachen sein kann.
Andere grüßten mit einem Kopfnicken. Kannten sie mich? Hatten sie alle, wie U Ba, auf meine Ankunft gewartet? Ich wollte sie nicht sehen. Ich wusste nicht, wie ich ihren Gruß erwidern sollte und lief so schnell ich konnte die Hauptstraße hinunter, den Blick auf ein imaginäres Ziel in der Ferne gerichtet.
Ich sehnte mich nach New York, nach dem Krach und dem Verkehr. Nach den ernsten und abweisenden Gesichtern der Passanten, die aneinander vorbeilaufen, ohne einander zu beachten. Selbst nach dem Gestank der übervollen Mülltonnen an einem schwülen, stickigen Sommerabend sehnte ich mich. Nach irgendetwas Vertrautem, etwas, an dem ich mich festhalten konnte, das Schutz versprach. Ich wollte zurück an einen Ort, an dem ich mich zu bewegen und zu verhalten wusste.
Etwa hundert Meter weiter gabelte sich der Weg. Ich hatte vergessen, wo mein Hotel lag. Ich blickte mich um, suchte nach einem Hinweis, ein Schild vielleicht oder ein Detail am Straßenrand, ein Busch, ein Baum, ein Haus, das ich vom Hinweg erinnerte und das mir die Richtung weisen könnte. Ich sah nur monströse lilafarbene Bougainvilleabüsche, die höher waren als die Hütten, die sich dahinter verbargen, sah vertrocknete Felder, staubige Bürgersteige und Schlaglöcher, so tief, dass sie Basketbälle verschlingen könnten. Wohin ich blickte, es sah alles gleich aus, fremd und unheimlich.
Sollte ich, Julia Win aus New York, der in Manhattan jede Straße, jede Avenue vertraut ist, sollte ich mich in diesem Kaff mit seinen drei Längs- und vier Querstraßen verlaufen haben? Wo waren mein Gedächtnis, mein Sinn für Orte, meine Souveränität, mit denen ich mich in San Francisco, Paris und London zurechtgefunden hatte? Wie konnte ich so leicht die Orientierung verlieren? Ein Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit kroch in mir hoch, wie ich es in New York noch nie empfunden hatte.
»Miss Win, Miss Win«, rief jemand.
Ich wagte kaum, mich umzudrehen und blickte über die Schulter zurück. Hinter mir stand ein junger Mann, den ich nicht kannte. Er erinnerte mich an den Pagen im Hotel. Oder den Kellner im Teehaus. An den Kofferträger am Flughafen in Rangun, an den Taxifahrer. Sie sahen alle gleich aus, mit ihren schwarzen Haaren, den tiefbraunen Augen, ihrer dunklen Haut und diesem unheimlichen Lächeln.
»Suchen Sie etwas, Miss Win? Kann ich Ihnen helfen?«
»Nein, danke«, sagte ich, die dem Fremden misstraute und nicht auf seine Hilfe angewiesen sein wollte.
»Ja, mein Hotel, den Weg«, sagte ich, die sich nach nichts mehr sehnte als nach einem Versteck, und sei es das erst heute Morgen bezogene Hotelzimmer.
»Hier rechts den Berg hinauf, dann sehen Sie es. Keine fünf Minuten«, erklärte er.
»Danke.«
»Ich hoffe, Sie haben eine schöne Zeit bei uns. Willkommen in Kalaw«, sagte er und ging weiter.
Im Hotel ging ich grußlos an der lächelnden Empfangsdame vorbei, stieg die schwere Holztreppe hinauf in den ersten Stock und sank auf mein Bett. Ich war erschöpft, wie selten zuvor in meinem Leben.
Mehr als zweiundsiebzig Stunden war ich von New York nach Rangun unterwegs gewesen. Anschließend hatte ich eine Nacht und einen halben Tag in einem alten Bus verbracht mit Menschen, die stanken und nichts am Leib trugen als schmutzige Röcke, verlumpte T-Shirts und zerschlissene Plastiksandalen. Mit Hühnern und quiekenden Ferkeln. Zwanzig Stunden Fahrt über Wege, die mit Straßen nichts gemein hatten. Ausgetrocknete Flussbetten waren das. Nur um von der Hauptstadt in diesen entlegenen Winkel zu gelangen. Warum?
Was machte ich in diesem Nest in den Bergen Birmas? Ich hatte hier nichts verloren und hoffte doch, etwas zu finden. Ich war auf der Suche, ohne wirklich zu wissen wonach.
Ich musste geschlafen haben. Die Sonne war verschwunden, draußen dämmerte es, und mein Zimmer lag im Halbdunkel. Mein Koffer stand unausgepackt auf dem anderen Bett. Ich blickte durch den Raum, meine Augen wanderten hin und her, als müsste ich mich vergewissern, wo ich war. Über mir unter der mindestens vier Meter hohen Decke hing ein alter Holzventilator. Das Zimmer war groß, und die spartanische Einrichtung hatte etwas Klösterliches. Neben der Tür ein schlichter Schrank, vor dem Fenster ein Tisch mit einem Stuhl, zwischen den Betten ein kleiner Nachttisch. Die Wände waren weiß gekalkt, keine Bilder oder Spiegel, die alten Holzdielen des Fußbodens blank poliert. Einziger Luxus war ein koreanischer Minikühlschrank. Er war kaputt. Durch die offenen Fenster wehte kühlere Abendluft, die gelben Vorhänge bewegten sich im Wind, langsam und behäbig.
In der Abenddämmerung, mit ein paar Stunden Abstand, erschien mir die Begegnung mit dem alten Mann noch absurder und rätselhafter als am Mittag. Die Erinnerung daran war verschwommen und unklar. Bilder spukten mir durch den Kopf, Bilder, die ich nicht deuten konnte, und die keinen Sinn ergaben. Ich versuchte mich zu erinnern. U Ba hatte weißes, volles, aber ganz kurz geschnittenes Haar und um den Mund ein Lächeln, von dem ich nicht wusste, was es bedeutete. War es höhnisch, spöttisch? Mitleidig?
Was wollte er von mir?
Geld! Was sonst. Er hat nicht danach gefragt, aber die Bemerkungen über seine Zähne und sein Hemd waren ein Hinweis, ich habe ihn wohl verstanden. Meinen Namen kann er vom Hotel bekommen haben, wahrscheinlich arbeitete er mit dem Empfang zusammen. Ein Trickbetrüger, der mich neugierig machen, mich beeindrucken wollte, um mir dann seine Künste als Wahrsager, Astrologe oder Handleser anzubieten. Ich glaube an nichts davon. Wenn der wüsste, wie er seine Zeit vergeudet.
Hat er mir etwas über meinen Vater verraten, was mich veranlassen könnte zu glauben, dass er ihn wirklich kennt? »Ich bin kein religiöser Mensch, und die Liebe, U Ba, die Liebe ist die einzige Kraft, an die ich wirklich glaube«, soll er zu ihm gesagt haben. Nie hätte mein Vater so einen Satz auch nur gedacht, geschweige denn ausgesprochen. Mit Sicherheit nicht einem Fremden gegenüber. Oder täuschte ich mich? War es nicht eher eine lächerliche Anmaßung meinerseits, zu denken, ich wüsste was mein Vater gedacht oder gefühlt hat? Wie vertraut war er mir?
Wäre er sonst verschwunden, einfach so, ohne einen Brief zum Abschied? Hätte er seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter zurückgelassen ohne Erklärung, ohne Nachricht?
Seine Spur verliert sich in Bangkok, sagt die Polizei. Er könnte in Thailand beraubt und ermordet worden sein.
Oder wurde er am Golf von Siam Opfer eines Unfalls? Wollte er nur einmal zwei Wochen völlig ungestört sein, ist weiter an die Küste gefahren und beim Schwimmen ertrunken? Das ist die Version unserer Familie, die offizielle zumindest.
Die Mordkommission vermutete, dass er ein Doppelleben führte. Sie wollten meiner Mutter nicht glauben, dass sie nichts über die ersten zwanzig Jahre im Leben meines Vaters wusste. Sie hielten das für so ausgeschlossen, dass sie meine Mutter zunächst verdächtigten, bei seinem Verschwinden eine Rolle zu spielen, entweder als seine Komplizin oder als Täterin. Erst als feststand, dass es keine hoch dotierte Lebensversicherung gab und niemand von seinem möglichen Tod finanziell profitieren würde, lag auch nicht mehr der Schatten eines Verdachts auf ihr. Verbarg sich hinter dem Geheimnis der ersten zwanzig Lebensjahre meines Vaters eine Seite, die wir, seine Familie, nicht kannten? War er ein heimlicher Homosexueller? Ein Kinderschänder, der seine Lust in den Bordellen Bangkoks befriedigte?
Wollte ich das wirklich wissen? Wollte ich mein Bild von ihm, das des treuen Ehemanns, des erfolgreichen Anwalts, des guten und starken Vaters, der für seine Kinder da war, wenn sie ihn brauchten, wollte ich das befleckt sehen? Du sollst dir kein Bildnis machen. Als ob wir ohne leben könnten. Wie viel Wahrheit vertrage ich?
Was hat mich bis ans andere Ende der Welt getrieben? Nicht die Trauer, diese Phase ist vorüber. Vier Jahre sind eine lange Zeit. Ich habe getrauert, aber ich merkte bald, dass der banale Satz stimmt: Das Leben geht weiter. Auch ohne ihn. Meine Freunde behaupteten, ich sei über die Sache, wie sie es nannten, schnell hinweggekommen.
Es ist auch nicht die Sorge, die mich suchen lässt. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass mein Vater noch am Leben ist, oder, sollte ich mich täuschen, dass er mich braucht oder ich etwas für ihn tun könnte.
Es ist die Ungewissheit, die mir keine Ruhe lässt. Die Frage, warum er verschollen ist und ob sein Verschwinden mir etwas über ihn verrät, das ich nicht weiß. Kannte ich ihn so gut, wie ich glaube, oder war unser Verhältnis, unsere Nähe, eine Illusion? Diese Zweifel sind schlimmer als die Angst vor der Wahrheit. Sie werfen einen Schatten auf meine Kindheit, auf meine Vergangenheit, und ich beginne, meinen Erinnerungen zu misstrauen. Und sie sind das Einzige, was mir geblieben ist. Wer war der Mann, der mich großgezogen hat? Mit wem habe ich über zwanzig Jahre meines Lebens zusammengelebt? Wer war mein Vater wirklich?
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
»Entschuldigen Sie vielmals, junge Frau, dass ich Sie so einfach anspreche«, sagte er und setzte sich zu mir. »Es ist sehr unhöflich, ich weiß, zumal wir uns nicht kennen oder zumindest Sie mich nicht kennen, nicht einmal flüchtig. Ich heiße U Ba und habe schon viel von Ihnen gehört, was aber mein Verhalten, ich gebe es zu, auch nicht höflicher macht. Ich vermute, es ist Ihnen unangenehm, in einem Teehaus, an einem fremden Ort, in einem fremden Land von einem Ihnen unbekannten Mann angesprochen zu werden, und ich habe dafür mehr als Verständnis, aber ich möchte, oder sollte ich ehrlicher sein und sagen, ich muss Sie etwas fragen. Ich habe auf diese Gelegenheit zu lange gewartet, als dass ich nun, da Sie da sind, schweigend vor Ihnen sitzen könnte.
Vier Jahre habe ich gewartet, um genau zu sein, und oft bin ich am Nachmittag auf und ab gegangen, dort, an der staubigen Hauptstraße, wo der Bus ankommt, der die wenigen Touristen bringt, die sich in unseren Ort verirren. Manchmal, wenn sich die Gelegenheit ergab, bin ich an den seltenen Tagen, an denen eine Maschine aus der Hauptstadt landet, zu unserem kleinen Flughafen gefahren und habe, vergeblich, Ausschau nach Ihnen gehalten.
Sie haben sich Zeit gelassen.
Nicht, dass ich Ihnen das vorwerfen möchte, bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich bin ein älterer Mann, der nicht weiß, wie viele Jahre ihm noch gegeben sind. In unserem Land altern die Menschen schnell und sterben früh. Mein Leben neigt sich langsam, und ich habe noch eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die für Sie bestimmt ist.
Sie lächeln. Sie halten mich für übergeschnappt, für ein wenig verrückt oder zumindest sehr verschroben? Dazu haben Sie jedes Recht. Nur bitte, bitte, wenden Sie sich nicht ab. Das alles mag rätselhaft und sonderbar für Sie klingen, und ich gestehe ein, dass mein Äußeres nicht dazu angetan ist, Ihr Vertrauen zu erwecken. Ich wünschte, ich hätte strahlend weiße Zähne wie Sie und nicht diese braunen Stummel im Mund, die nicht einmal mehr zum Kauen richtig taugen, diese Trümmer eines Gebisses. Meine Haut ist welk und schlaff und hängt von meinen Armen, als hätte ich sie dort zum Trocknen abgelegt. Man sagt, ich stinke aus dem Mund, meine Füße sind schmutzig und zerschunden vom jahrzehntelangen Laufen in billigen Sandalen, mein Hemd, das einmal weiß war, hätte eigentlich schon vor Jahren in den Müll gehört. Glauben Sie mir, ich bin ein reinlicher Mensch, aber Sie sehen, in welchem Zustand sich unser Land befindet. Beschämend. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, aber ich kann es nicht ändern, und es hat mich viele Jahre meines Lebens gekostet zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Lassen Sie sich nicht von meiner äußeren Erscheinung in die Irre führen. Verwechseln Sie meinen Gleichmut nicht mit Desinteresse oder Resignation. Nichts läge mir ferner, meine Liebe.
Ich schweife ab, und ich sehe in Ihren Augen, dass ich Ihre Geduld strapaziere. Bitte, sehen Sie es mir nach, und wenden Sie sich nicht ab. Es wartet doch niemand auf Sie, habe ich Recht? Sie sind allein gekommen, so wie ich es erwartet hatte. Geben Sie mir ein paar Minuten Ihrer Zeit. Bleiben Sie noch etwas bei mir, Julia.
Sie staunen? Ihre wunderschönen braunen Augen werden noch größer, und zum ersten Mal schauen Sie mich wirklich an. Sie sind erschrocken. Sie fragen sich, woher ich Ihren Namen weiß, da wir uns doch noch nie gesehen haben und Sie zum ersten Mal in unserem Land zu Gast sind? Kann es Zufall sein? Sie überlegen, ob ich vielleicht irgendwo ein Schild mit Ihrem Namen an Ihrer Jacke oder Ihrem kleinen Rucksack gesehen habe? Nein, habe ich nicht, glauben Sie mir. Ich kenne Ihren Namen, so wie ich den Tag und die Stunde Ihrer Geburt kenne, ich weiß um die kleine Jule, die nichts mehr liebte, als von Ihrem Vater Geschichten erzählt zu bekommen, und ich könnte Ihnen hier und jetzt Jules Lieblingsmärchen erzählen. Die Geschichte vom Prinzen, der Prinzessin und dem Krokodil.
Julia Win. Geboren am 28. August 1968 in New York City. Mutter Amerikanerin. Vater Birmane. Ihr Familienname ist Teil meiner Geschichte, Teil meines Lebens, seit ich vor fünfundfünfzig Jahren aus dem Schoß meiner Mutter kroch, und in den vergangenen vier Jahren gab es keinen Tag, an dem ich nicht an Sie gedacht hätte. Ich werde Ihnen alles später erklären, aber lassen Sie mich zuerst meine Frage stellen: Glauben Sie an die Liebe?
Sie lachen. Wie schön Sie sind. Ich meine es ernst. Glauben Sie an die Liebe, Julia?
Selbstverständlich spreche ich nicht von dem Ausbruch an Leidenschaft von dem wir meinen, er wird unser Leben lang nicht enden, der uns Dinge tun und sagen lässt, die wir später bereuen, der uns glauben machen will, dass wir ohne einen bestimmten Menschen nicht leben können, der uns vor Angst erzittern lässt bei dem Gedanken, wir könnten diesen Menschen wieder verlieren. Dieses Gefühl, das uns ärmer und nicht reicher macht, weil wir besitzen wollen, was wir nicht besitzen können, weil wir festhalten wollen, was wir nicht festhalten können. Ich meine auch nicht die körperliche Begierde und nicht die Eigenliebe, diesen Parasiten, der sich so gern als selbstlose Liebe tarnt.
Ich spreche von der Liebe, die Blinde zu Sehenden macht. Von der Liebe, die stärker ist als die Angst. Ich spreche von der Liebe, die dem Leben einen Sinn einhaucht, die nicht den Gesetzen des Verfalls gehorcht, die uns wachsen lässt und keine Grenzen kennt. Ich spreche vom Triumph des Menschen über die Eigensucht und den Tod.
Sie schütteln den Kopf? Daran glauben Sie nicht? Oh, Sie wissen gar nicht, wovon ich spreche? Das überrascht mich nicht, mir erging es ähnlich, bevor ich Ihren Vater traf. Warten Sie ab, Sie werden verstehen, was ich meine, sobald ich Ihnen die Geschichte erzählt habe, die ich seit vier Jahren für Sie mit mir herumtrage. Nur um ein wenig Geduld muss ich Sie bitten. Es ist spät geworden, und Sie sind sicherlich müde von der langen Reise. Ich für meinen Teil muss mit meinen Kräften haushalten und bitte um Ihr Verständnis, wenn ich mich jetzt zurückziehe. Wenn es Ihnen genehm ist, sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit an diesem Tisch in diesem Teehaus wieder. Hier traf ich, wenn ich das noch erwähnen darf, Ihren Vater, und um ganz ehrlich zu sein, dort, auf Ihrem Schemel hockte er und begann zu erzählen, und ich saß hier, auf diesem Platz, staunend, ja, ich gebe zu, ungläubig und verwirrt. Ich hatte noch nie einen Menschen so erzählen hören. Können Worte Flügel haben? Können sie wie Schmetterlinge durch die Luft gleiten? Können sie uns mitreißen, davontragen in eine andere Welt? Können sie uns erbeben lassen wie die Naturgewalten, die die Erde erschüttern? Können sie die letzten geheimen Kammern unserer Seele öffnen? Ich weiß nicht, ob Worte allein es vermögen, aber zusammen mit der menschlichen Stimme können sie es, Julia, und Ihr Vater hatte an diesem Tag eine Stimme, wie wir sie vielleicht nur einmal im Leben haben. Er erzählte nicht, er sang, und obwohl er flüsterte, gab es in diesem Teehaus keinen Menschen, dem nicht die Tränen kamen, allein vom Klang seiner Stimme. Aus seinen Sätzen wurde bald eine Geschichte und aus der Geschichte ein Leben, das seine Kraft entfaltete und seine Magie. Was ich hörte, machte mich zu einem Gläubigen, wie Ihren Vater.
›Ich bin kein religiöser Mensch, und die Liebe, U Ba, die Liebe ist die einzige Kraft, an die ich wirklich glaube.‹ Das sind die Worte Ihres Vaters.«
U Ba schaute mich an und erhob sich. Er legte die Hände vor der Brust aneinander, ohne sie zu falten, machte die Andeutung einer Verneigung und verließ mit ein paar schnellen, leichtfüßigen Schritten das Teehaus.
Ich blickte ihm nach, bis er im Gewühl der Straße verschwunden war.
Nein, wollte ich ihm hinterherrufen, nein, ich glaube an keine Kraft, die Blinde zu Sehenden macht. Ich glaube nicht an Wunder und nicht an Magie. Das Leben ist kurz, zu kurz, um Zeit mit solchen Hoffnungen zu verschwenden. Ich genieße es, wie es ist, anstatt mir Illusionen zu machen. Ob ich an die Liebe glaube? Was für eine Frage. Als wäre die Liebe eine Religion, an die man glaubt oder nicht. Als Achtzehnjährige habe ich von dem Prinzen geträumt, der kommt und mich rettet und befreit, und als er kam, musste ich lernen, dass es Prinzen nur im Märchen gibt, und dass die Liebe blind macht und nicht sehend. Nein, wollte ich dem Alten hinterherrufen, ich glaube an keine Kraft, die stärker ist als die Angst, ich glaube nicht an einen Triumph über den Tod. Nein. Nein.
Stattdessen hockte ich auf meinem Hocker, zusammengesunken und eingefallen. Ich hörte noch immer seine Stimme, sie war weich und melodisch, in ihrer Sanftheit der meines Vaters nicht unähnlich. Seine Worte hallten in meinem Kopf wie ein Echo, das keine Ende nehmen will.
Bleiben Sie noch etwas bei mir, Julia, Julia, Julia...
Glauben Sie an die Liebe, an die Liebe...
Die Worte Ihres Vaters, Ihres Vaters...
Ich hatte Kopfschmerzen und fühlte mich erschöpft. Als wäre ich aus einem Albtraum erwacht, der nicht aufhörte, mich zu quälen. Um mich herum summten Fliegen, setzten sich auf meine Haare, meine Stirn und meine Hände. Mir fehlte die Kraft, sie zu verscheuchen. Vor mir lagen drei trockene Kekse, auf dem Tisch klebte brauner Zucker.
Ich wollte einen Schluck von meinem Tee trinken. Er war kalt, und meine Hand zitterte. Die Finger umklammerten das Glas, es glitt mir aus der Hand, langsam, wie in Zeitlupe konnte ich sehen, dass es rutschte, so kräftig ich auch drückte. Das Geräusch des zersplitternden Glases auf dem Fußboden. Die Blicke der anderen Gäste. Als hätte ich eine Schrankwand mit Gläsern umgestoßen. Warum hatte ich diesem Fremden so lange zugehört? Ich hätte ihn bitten können zu schweigen. Ich hätte ihm klar und unmissverständlich sagen müssen, er solle mich in Ruhe lassen. Ich hätte aufstehen können. Irgendetwas hielt mich. Ich hatte mich abwenden wollen, da sagte er: Julia, Julia Win. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass ich bei der Erwähnung meines Namens je so erschrecken würde. Mein Herz raste.Woher wusste er meinen Namen? Was wusste er noch von mir? Kannte er meinen Vater? Wann hatte er ihn zuletzt gesehen? Weiß er womöglich, ob mein Vater noch am Leben ist, wo er steckt?
2
Der Kellner wollte mein Geld nicht.
»Sie sind eine Freundin von U Ba. Seine Freunde sind unsere Gäste«, sagte er und verneigte sich.
Ich holte dennoch einen Geldschein aus meiner Hosentasche. Er war dreckig und abgegriffen, ich ekelte mich und schob ihn unter den Teller mit den Keksen. Der Kellner räumte das Geschirr ab, ohne den Schein zu berühren. Ich deutete auf das Geld, er lächelte nur.
War es ihm zu wenig, zu schmutzig oder nicht gut genug? Ich legte eine größere und saubere Note auf den Tisch. Er verbeugte sich, lächelte wieder und rührte sie nicht an.
Draußen war es noch heißer. Die Hitze lähmte mich, ich stand vor dem Teehaus, unfähig einen Schritt zu tun. Die Sonne brannte auf meiner Haut, und das grelle Licht stach in den Augen. Ich setzte meine Baseballmütze auf und zog sie tief ins Gesicht.
Die Straße war voller Menschen, gleichzeitig herrschte eine seltsame Stille. Irgendetwas fehlte, und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was es war. Es gab kaum motorisierte Fahrzeuge. Die Menschen gingen zu Fuß oder waren mit dem Fahrrad unterwegs. An einer Kreuzung parkten drei Pferdekutschen und ein Ochsenkarren. Die wenigen Autos, die es zu sehen gab, waren alte japanische Pick-up Trucks, zerbeult und verrostet, voll beladen mit großen Bastkörben und Säcken, an denen sich junge Männer festgeklammert hielten.
Die Straße war gesäumt von flachen, einstöckigen Holzbuden mit Wellblechdächern, wie ich sie aus dem Fernsehen von Slums in Afrika oder Südamerika kannte. Es waren Geschäfte, Kaufhäuser auf zehn Quadratmetern, die alles anboten von Reis, Erdnüssen, Mehl und Haarshampoo bis zu Coca Cola und Bier. Die Ware lag wild durcheinander, es gab keine Ordnung oder aber eine, die mir fremd war.
Jeder zweite Laden schien ein Teehaus zu sein, die Gäste hockten auf kleinen Holzschemeln davor. Um den Kopf hatten sie sich rote und grüne Frotteehandtücher gewickelt, ein Kopfschmuck, der ihnen so selbstverständlich war, wie mir meine dunkelblaue New-York-Yankee-Baseballmütze. Anstelle von Hosen trugen die Männer Gewänder, die wie Wickelröcke aussahen, und sie rauchten lange dunkelgrüne Zigarillos.
Vor mir standen ein paar Frauen. Sie hatten sich gelbe Paste auf Wangen, Stirn und Nase geschmiert und sahen aus wie Indianerinnen auf dem Kriegspfad, und jede paffte einen dieser stinkenden grünen Stummel.
Ich überragte sie alle um mindestens einen Kopf, auch die Männer. Sie waren schlank, ohne dabei hager zu wirken, und sie bewegten sich mit der Eleganz und Leichtigkeit, die ich an meinem Vater immer bewundert hatte. Dagegen fühlte ich mich fett und schwerfällig mit meinen sechzig Kilo und meiner Größe von 1,76.
Am schlimmsten waren ihre Blicke.
Sie wichen mir nicht aus, sie schauten mir direkt ins Gesicht und in die Augen und lächelten. Es war kein Lächeln, das ich kannte.
Wie bedrohlich ein Lachen sein kann.
Andere grüßten mit einem Kopfnicken. Kannten sie mich? Hatten sie alle, wie U Ba, auf meine Ankunft gewartet? Ich wollte sie nicht sehen. Ich wusste nicht, wie ich ihren Gruß erwidern sollte und lief so schnell ich konnte die Hauptstraße hinunter, den Blick auf ein imaginäres Ziel in der Ferne gerichtet.
Ich sehnte mich nach New York, nach dem Krach und dem Verkehr. Nach den ernsten und abweisenden Gesichtern der Passanten, die aneinander vorbeilaufen, ohne einander zu beachten. Selbst nach dem Gestank der übervollen Mülltonnen an einem schwülen, stickigen Sommerabend sehnte ich mich. Nach irgendetwas Vertrautem, etwas, an dem ich mich festhalten konnte, das Schutz versprach. Ich wollte zurück an einen Ort, an dem ich mich zu bewegen und zu verhalten wusste.
Etwa hundert Meter weiter gabelte sich der Weg. Ich hatte vergessen, wo mein Hotel lag. Ich blickte mich um, suchte nach einem Hinweis, ein Schild vielleicht oder ein Detail am Straßenrand, ein Busch, ein Baum, ein Haus, das ich vom Hinweg erinnerte und das mir die Richtung weisen könnte. Ich sah nur monströse lilafarbene Bougainvilleabüsche, die höher waren als die Hütten, die sich dahinter verbargen, sah vertrocknete Felder, staubige Bürgersteige und Schlaglöcher, so tief, dass sie Basketbälle verschlingen könnten. Wohin ich blickte, es sah alles gleich aus, fremd und unheimlich.
Sollte ich, Julia Win aus New York, der in Manhattan jede Straße, jede Avenue vertraut ist, sollte ich mich in diesem Kaff mit seinen drei Längs- und vier Querstraßen verlaufen haben? Wo waren mein Gedächtnis, mein Sinn für Orte, meine Souveränität, mit denen ich mich in San Francisco, Paris und London zurechtgefunden hatte? Wie konnte ich so leicht die Orientierung verlieren? Ein Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit kroch in mir hoch, wie ich es in New York noch nie empfunden hatte.
»Miss Win, Miss Win«, rief jemand.
Ich wagte kaum, mich umzudrehen und blickte über die Schulter zurück. Hinter mir stand ein junger Mann, den ich nicht kannte. Er erinnerte mich an den Pagen im Hotel. Oder den Kellner im Teehaus. An den Kofferträger am Flughafen in Rangun, an den Taxifahrer. Sie sahen alle gleich aus, mit ihren schwarzen Haaren, den tiefbraunen Augen, ihrer dunklen Haut und diesem unheimlichen Lächeln.
»Suchen Sie etwas, Miss Win? Kann ich Ihnen helfen?«
»Nein, danke«, sagte ich, die dem Fremden misstraute und nicht auf seine Hilfe angewiesen sein wollte.
»Ja, mein Hotel, den Weg«, sagte ich, die sich nach nichts mehr sehnte als nach einem Versteck, und sei es das erst heute Morgen bezogene Hotelzimmer.
»Hier rechts den Berg hinauf, dann sehen Sie es. Keine fünf Minuten«, erklärte er.
»Danke.«
»Ich hoffe, Sie haben eine schöne Zeit bei uns. Willkommen in Kalaw«, sagte er und ging weiter.
Im Hotel ging ich grußlos an der lächelnden Empfangsdame vorbei, stieg die schwere Holztreppe hinauf in den ersten Stock und sank auf mein Bett. Ich war erschöpft, wie selten zuvor in meinem Leben.
Mehr als zweiundsiebzig Stunden war ich von New York nach Rangun unterwegs gewesen. Anschließend hatte ich eine Nacht und einen halben Tag in einem alten Bus verbracht mit Menschen, die stanken und nichts am Leib trugen als schmutzige Röcke, verlumpte T-Shirts und zerschlissene Plastiksandalen. Mit Hühnern und quiekenden Ferkeln. Zwanzig Stunden Fahrt über Wege, die mit Straßen nichts gemein hatten. Ausgetrocknete Flussbetten waren das. Nur um von der Hauptstadt in diesen entlegenen Winkel zu gelangen. Warum?
Was machte ich in diesem Nest in den Bergen Birmas? Ich hatte hier nichts verloren und hoffte doch, etwas zu finden. Ich war auf der Suche, ohne wirklich zu wissen wonach.
Ich musste geschlafen haben. Die Sonne war verschwunden, draußen dämmerte es, und mein Zimmer lag im Halbdunkel. Mein Koffer stand unausgepackt auf dem anderen Bett. Ich blickte durch den Raum, meine Augen wanderten hin und her, als müsste ich mich vergewissern, wo ich war. Über mir unter der mindestens vier Meter hohen Decke hing ein alter Holzventilator. Das Zimmer war groß, und die spartanische Einrichtung hatte etwas Klösterliches. Neben der Tür ein schlichter Schrank, vor dem Fenster ein Tisch mit einem Stuhl, zwischen den Betten ein kleiner Nachttisch. Die Wände waren weiß gekalkt, keine Bilder oder Spiegel, die alten Holzdielen des Fußbodens blank poliert. Einziger Luxus war ein koreanischer Minikühlschrank. Er war kaputt. Durch die offenen Fenster wehte kühlere Abendluft, die gelben Vorhänge bewegten sich im Wind, langsam und behäbig.
In der Abenddämmerung, mit ein paar Stunden Abstand, erschien mir die Begegnung mit dem alten Mann noch absurder und rätselhafter als am Mittag. Die Erinnerung daran war verschwommen und unklar. Bilder spukten mir durch den Kopf, Bilder, die ich nicht deuten konnte, und die keinen Sinn ergaben. Ich versuchte mich zu erinnern. U Ba hatte weißes, volles, aber ganz kurz geschnittenes Haar und um den Mund ein Lächeln, von dem ich nicht wusste, was es bedeutete. War es höhnisch, spöttisch? Mitleidig?
Was wollte er von mir?
Geld! Was sonst. Er hat nicht danach gefragt, aber die Bemerkungen über seine Zähne und sein Hemd waren ein Hinweis, ich habe ihn wohl verstanden. Meinen Namen kann er vom Hotel bekommen haben, wahrscheinlich arbeitete er mit dem Empfang zusammen. Ein Trickbetrüger, der mich neugierig machen, mich beeindrucken wollte, um mir dann seine Künste als Wahrsager, Astrologe oder Handleser anzubieten. Ich glaube an nichts davon. Wenn der wüsste, wie er seine Zeit vergeudet.
Hat er mir etwas über meinen Vater verraten, was mich veranlassen könnte zu glauben, dass er ihn wirklich kennt? »Ich bin kein religiöser Mensch, und die Liebe, U Ba, die Liebe ist die einzige Kraft, an die ich wirklich glaube«, soll er zu ihm gesagt haben. Nie hätte mein Vater so einen Satz auch nur gedacht, geschweige denn ausgesprochen. Mit Sicherheit nicht einem Fremden gegenüber. Oder täuschte ich mich? War es nicht eher eine lächerliche Anmaßung meinerseits, zu denken, ich wüsste was mein Vater gedacht oder gefühlt hat? Wie vertraut war er mir?
Wäre er sonst verschwunden, einfach so, ohne einen Brief zum Abschied? Hätte er seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter zurückgelassen ohne Erklärung, ohne Nachricht?
Seine Spur verliert sich in Bangkok, sagt die Polizei. Er könnte in Thailand beraubt und ermordet worden sein.
Oder wurde er am Golf von Siam Opfer eines Unfalls? Wollte er nur einmal zwei Wochen völlig ungestört sein, ist weiter an die Küste gefahren und beim Schwimmen ertrunken? Das ist die Version unserer Familie, die offizielle zumindest.
Die Mordkommission vermutete, dass er ein Doppelleben führte. Sie wollten meiner Mutter nicht glauben, dass sie nichts über die ersten zwanzig Jahre im Leben meines Vaters wusste. Sie hielten das für so ausgeschlossen, dass sie meine Mutter zunächst verdächtigten, bei seinem Verschwinden eine Rolle zu spielen, entweder als seine Komplizin oder als Täterin. Erst als feststand, dass es keine hoch dotierte Lebensversicherung gab und niemand von seinem möglichen Tod finanziell profitieren würde, lag auch nicht mehr der Schatten eines Verdachts auf ihr. Verbarg sich hinter dem Geheimnis der ersten zwanzig Lebensjahre meines Vaters eine Seite, die wir, seine Familie, nicht kannten? War er ein heimlicher Homosexueller? Ein Kinderschänder, der seine Lust in den Bordellen Bangkoks befriedigte?
Wollte ich das wirklich wissen? Wollte ich mein Bild von ihm, das des treuen Ehemanns, des erfolgreichen Anwalts, des guten und starken Vaters, der für seine Kinder da war, wenn sie ihn brauchten, wollte ich das befleckt sehen? Du sollst dir kein Bildnis machen. Als ob wir ohne leben könnten. Wie viel Wahrheit vertrage ich?
Was hat mich bis ans andere Ende der Welt getrieben? Nicht die Trauer, diese Phase ist vorüber. Vier Jahre sind eine lange Zeit. Ich habe getrauert, aber ich merkte bald, dass der banale Satz stimmt: Das Leben geht weiter. Auch ohne ihn. Meine Freunde behaupteten, ich sei über die Sache, wie sie es nannten, schnell hinweggekommen.
Es ist auch nicht die Sorge, die mich suchen lässt. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass mein Vater noch am Leben ist, oder, sollte ich mich täuschen, dass er mich braucht oder ich etwas für ihn tun könnte.
Es ist die Ungewissheit, die mir keine Ruhe lässt. Die Frage, warum er verschollen ist und ob sein Verschwinden mir etwas über ihn verrät, das ich nicht weiß. Kannte ich ihn so gut, wie ich glaube, oder war unser Verhältnis, unsere Nähe, eine Illusion? Diese Zweifel sind schlimmer als die Angst vor der Wahrheit. Sie werfen einen Schatten auf meine Kindheit, auf meine Vergangenheit, und ich beginne, meinen Erinnerungen zu misstrauen. Und sie sind das Einzige, was mir geblieben ist. Wer war der Mann, der mich großgezogen hat? Mit wem habe ich über zwanzig Jahre meines Lebens zusammengelebt? Wer war mein Vater wirklich?
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
... weniger
Autoren-Porträt von Jan-Philipp Sendker
Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asienkorrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen Mauer. Nach dem Roman-Bestseller Das Herzenhören (2002) folgten Das Flüstern der Schatten (2007), Drachenspiele (2009), Herzenstimmen (2012), Am anderen Ende der Nacht (2016), Das Geheimnis des alten Mönches (2017), Das Gedächtnis des Herzens (2019) und Die Rebellin und der Dieb (2021). Seine Romane sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt. Mit weltweit über 3,5 Millionen verkauften Büchern ist er einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jan-Philipp Sendker
- 2012, Erstmals im TB, 302 Seiten, 2 Schwarz-Weiß-Abbildungen, Taschenbuch, Deutsch
- Verlag: Heyne
- ISBN-10: 3453410017
- ISBN-13: 9783453410015
- Erscheinungsdatum: 27.08.2012
Kommentare zu "Das Herzenhören / Die Burma-Serie Bd.1"
0 Gebrauchte Artikel zu „Das Herzenhören / Die Burma-Serie Bd.1“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|





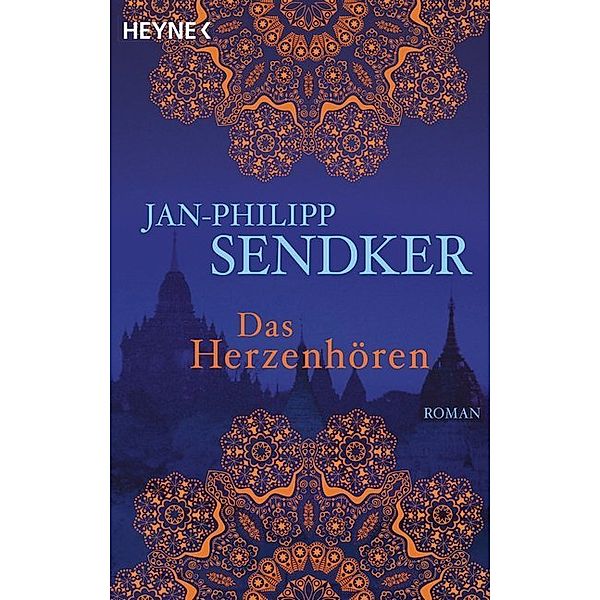

5 von 5 Sternen
5 Sterne 16Schreiben Sie einen Kommentar zu "Das Herzenhören / Die Burma-Serie Bd.1".
Kommentar verfassen