Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?
Eine philosophische Reise
Was ist Wahrheit? Woher weiß ich, wer ich bin? Was darf die Hirnforschung?
Eine unterhaltsame Einladung zum Nachdenken über das Abenteuer Leben! Precht führt angenehm lesbar durch die großen Fragen des Daseins.
lieferbar
versandkostenfrei
Taschenbuch
13.00 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? “
Was ist Wahrheit? Woher weiß ich, wer ich bin? Was darf die Hirnforschung?
Eine unterhaltsame Einladung zum Nachdenken über das Abenteuer Leben! Precht führt angenehm lesbar durch die großen Fragen des Daseins.
Klappentext zu „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? “
Philosophie für alleBücher über Philosophie gibt es viele. Aber Richard David Prechts Buch ist anders als alle anderen. Denn es gibt bisher keines, das den Leser so umfassend und kompetent - und unter Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse - an die großen philosophischen Fragen des Lebens herangeführt hätte: Was ist Wahrheit? Woher weiß ich, wer ich bin? Was darf die Hirnforschung? Prechts Buch schlägt einen weiten Bogen über die verschiedenen Disziplinen und ist eine beispiellose Orientierungshilfe in der schier unüberschaubaren Fülle unseres Wissens vom Menschen: Eine Einladung, lustvoll und spielerisch nachzudenken - über das Abenteuer Leben und seine Möglichkeiten!
Lese-Probe zu „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? “
Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? von Richard David PrechtSILS MARIA
Kluge Tiere im All - Was ist Wahrheit?
... mehr
»In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnen¬systemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der ›Weltgeschichte‹: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur er¬starrte das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben. - So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genü-gend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüch¬tig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt in¬nerhalb der Natur ausnimmt; es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm dreh¬ten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so wür¬den wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt.«
Der Mensch ist ein kluges Tier, das sich doch zugleich selbst völlig überschätzt. Denn sein Verstand ist nicht auf die große Wahrheit, sondern nur auf die kleinen Dinge im Leben ausge¬richtet. Kaum ein anderer Text in der Geschichte der Philoso¬phie hat auf so poetische wie schonungslose Weise dem Men¬schen den Spiegel vorgehalten. Geschrieben wurde dieser viel leicht schönste Anfang eines philosophischen Buches im Jahr 1873 unter dem Titel: Über Wahrheit und Lüge im außermora¬lischen Sinne. Und sein Verfasser war ein junger, gerade 29-jäh¬riger Professor für Altphilologie an der Universität Basel.
Doch Friedrich Nietzsche veröffentlichte seinen Text über die klugen und hochmütigen Tiere nicht. Soeben hatte er schwere Blessuren davongetragen, weil er ein Buch über die Grundlagen der griechischen Kultur geschrieben hatte. Seine Kritiker ent¬larvten es als unwissenschaftlich und als spekulativen Unsinn, was es wohl weitgehend auch ist. Von einem gescheiterten Wun¬derkind war die Rede, und sein Ruf als Altphilologe war ziem¬lich ruiniert.
Dabei hat alles so viel versprechend angefangen. Der kleine Fritz, 1844 im sächsischen Dorf Röcken geboren und aufge¬wachsen in Naumburg an der Saale, galt als ein hochbegabter und sehr gelehriger Schüler. Sein Vater war ein lutherischer Pfar¬rer, und auch die Mutter war sehr fromm. Als der Junge vier Jahre alt ist, stirbt der Vater und kurz darauf auch Nietzsches jüngerer Bruder. Die Familie zieht nach Naumburg, und Fritz wächst in einem reinen Frauenhaushalt auf. Auf der Knaben¬schule und später am Domgymnasium wird man auf sein Talent aufmerksam. Nietzsche besucht das angesehene Internat Schul¬pforta und schreibt sich 1864 an der Universität Bonn für klas¬sische Philologie ein. Das Theologiestudium, das er ebenfalls be¬ginnt, gibt er schon nach dem ersten Semester wieder auf. Zu gern hätte er der Mutter den Gefallen getan, ein rechter Pfarrer zu werden - allein ihm fehlt der Glaube. Der »kleine Pastor«, als der das fromme Pfarrerskind einst in Naumburg verspottet wurde, ist vom Glauben abgefallen. Die Mutter, das Pfarrhaus und der Glaube sind ein Gefängnis, aus dem er sich gesprengt hat, doch ein Leben lang wird dieser Wandel an ihm nagen. Nach einem Jahr wechselt Nietzsche mit seinem Professor nach Leip¬zig. Sein Ziehvater schätzt ihn so sehr, dass er ihn der Universität Basel als Professor empfiehlt. 1869 wird der 25-jährige außer ordentlicher Professor. Seine fehlenden Abschlüsse, Promotion und Habilitation, bekommt er kurzerhand von der Uni verlie¬hen. In der Schweiz lernt Nietzsche die Gelehrten und Künstler der Zeit kennen, darunter Richard Wagner und seine Frau Co¬sima, denen er zuvor bereits in Leipzig begegnet war. Nietzsches Begeisterung für Wagner ist so groß, dass er sich 1872 von des¬sen pathetischer Musik zu seinem nicht weniger pathetischen Fehlschlag über Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik verleiten lässt.
Nietzsches Buch war schnell abgetan. Der Gegensatz vom vermeintlich »Dionysischen« der Musik und dem vermeintlich »Apollinischen« der bildenden Kunst war schon seit der Früh-romantik bekannt und gemessen an der historischen Wahrheit eine wilde Spekulation. Außerdem beschäftigte sich die gelehrte Welt in Europa mit der Geburt einer viel wichtigeren Tragödie. Ein Jahr zuvor hat der studierte Theologe und renommierte eng¬lische Botaniker Charles Darwin sein Buch über die Abstam¬mung des Menschen aus dem Tierreich veröffentlicht. Obwohl der Gedanke, dass sich der Mensch aus primitiveren Vorformen entwickelt haben könnte, seit spätestens zwölf Jahren im Raum stand - Darwin selbst hat in seinem Buch über die Entstehung der Arten angekündigt, dass hieraus auch auf den Menschen »ein bezeichnendes Licht« fallen werde -, war das Buch ein Rei-ßer. In den 1860er Jahren hatten zahlreiche Naturforscher die gleiche Konsequenz gezogen und den Menschen ins Tierreich nahe dem gerade erst entdeckten Gorilla einsortiert. Die Kirche, vor allem in Deutschland, bekämpfte Darwin und seine Anhän¬ger noch bis zum Ersten Weltkrieg. Doch von Anfang an war klar, dass es nun kein freiwilliges Zurück zur früheren Weltsicht mehr geben konnte. Gott als persönlicher Urheber und Lenker des Menschen war tot. Und die Naturwissenschaften feierten ihren Siegeszug mit einem neuen sehr nüchternen Bild des Men¬schen: Das Interesse an Affen wurde größer als das an Gott. Und die erhabene Wahrheit vom Menschen als einer gottgleichen Kreatur zerfiel in zwei Teile: das unglaubwürdig gewor¬dene Erhabene und die schlichte Wahrheit vom Menschen als einem intelligenten Tier.
Nietzsches Begeisterung für diese neue Weltsicht ist groß. »Al¬les, was wir brauchen«, schreibt er später einmal, »ist eine Che¬mie der moralischen, religiösen, ästhetischen Vorstellungen und Empfindungen, ebenso wie all jener Regungen, welche wir im Groß- und Kleinverkehr der Kultur und Gesellschaft, ja in der Einsamkeit an uns erleben.« Genau an jener »Chemie« arbei¬ten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zahlreiche Wissen-schaftler und Philosophen: an einer biologischen Daseinslehre ohne Gott. Doch Nietzsche beteiligt sich selbst keinen Deut da¬ran. Die Frage, die ihn beschäftigt, ist eine ganz andere: Was bedeutet die nüchtern wissenschaftliche Sicht für das Selbstver¬ständnis des Menschen? Macht es den Menschen größer, oder macht es ihn kleiner? Hat er alles verloren, oder gewinnt er et¬was dazu, dadurch, dass er sich jetzt selbst klarer sieht? In die-ser Lage schrieb er den Aufsatz über Wahrheit und Lüge, seinen vielleicht schönsten Text.
Die Frage, ob der Mensch kleiner oder größer geworden war, beantwortete Nietzsche je nach Stimmung und Laune. Wenn es ihm schlecht ging - und es ging ihm oft schlecht -, war er ge¬drückt und zerknirscht und predigte ein Evangelium des Schmut¬zes. War er dagegen hochgestimmt, ergriff ihn ein stolzes Pathos und ließ ihn vom Übermenschen träumen. Seine hochfliegenden Phantasien und das donnernde Selbstbewusstsein seiner Bücher standen dabei in einem geradezu haarsträubenden Gegensatz zu seiner Erscheinung: ein kleiner, etwas dicklicher, weicher Mann. Ein trotziger Schnauzbart, eine richtige Bürste, sollte sein wei¬ches Gesicht aufmöbeln und männlicher machen, aber die vielen Krankheiten von Kindertagen an ließen ihn schwach erschei¬nen und sich schwach fühlen. Er war stark kurzsichtig, litt un¬ter Magenbeschwerden und schweren Migräneanfällen. Mit 35 fühlte er sich bereits als ein körperliches Wrack und beendete seine Lehrtätigkeit in Basel. Eine oft vermutete Syphilis-Infek¬tion, so scheint es, gab ihm später den Rest.
Im Sommer 1881, zwei Jahre nach seinem Abschied von der Universität, entdeckte Nietzsche eher zufällig sein ganz persön¬liches Paradies: den kleinen Ort Sils Maria im schweizerischen Oberengadin. Eine phantastische Landschaft, die ihn sofort be¬geisterte und inspirierte. Immer wieder fuhr er in den kommen¬den Jahren dorthin, unternahm lange einsame Spaziergänge und schmiedete neue pathetische Gedanken. Vieles davon brachte er im Winter in Rapallo und an der Mittelmeerküste, in Genua und in Nizza, zu Papier. Das meiste zeigt Nietzsche als einen klugen, literarisch anspruchsvollen und schonungslosen Kriti¬ker, der seine Finger in die Wunden der abendländischen Phi¬losophie legt. Was seine eigenen Vorschläge zu einer neuen Er¬kenntnistheorie und Moral anbelangt dagegen, begeistert er sich für einen unausgegorenen Sozialdarwinismus und flüchtet sich oft in schwiemeligen Kitsch. Je markiger seine Texte daherkom¬men, umso mehr sind sie mit großer Geste danebengegriffen. »Gott ist tot« - schreibt er das eine um das andere Mal -, aber das wissen die meisten seiner Zeitgenossen schon von Darwin und anderen.
1887, Nietzsche blickt das vorletzte Mal auf die schneebe¬deckten Gipfel von Sils Maria, entdeckt er das Thema von sei¬nen klugen Tieren aus dem alten Aufsatz wieder - das Problem von der begrenzten Erkenntnis aller Menschentiere. Seine Streit¬schrift Zur Genealogie der Moral beginnt mit den Worten: »Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst: Das hat seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht - wie sollte es geschehen, dass wir uns eines Tages fänden?« Wie so oft spricht er von sich selbst im Plural, wie von einer sehr spe¬ziellen Tierart, die er als Erster beschreibt: » Unser Schatz ist, wo die Bienenkörbe unsrer Erkenntnis stehn. Wir sind immer dazu unterwegs, als geborne Flügelthiere und Honigsammler des Geistes, wir kümmern uns von Herzen eigentlich nur um
Eins - Etwas >heimzubringen<. Viel Zeit dafür bleibt ihm nicht mehr. Zwei Jahre später erleidet Nietzsche in Turin einen Zu¬sammenbruch. Seine Mutter holt den 44-jährigen Sohn in Ita¬lien ab und bringt ihn nach Jena in eine Klinik. Später lebt er bei ihr, aber er bringt nichts mehr zu Papier. Acht Jahre darauf stirbt die Mutter, und der geistig schwer umnachtete Sohn kommt in die Wohnung seiner nicht sonderlich geliebten Schwester. Am 25 August 1900 stirbt Nietzsche in Weimar im Alter von 55 Jahren.
Nietzsches Selbstbewusstsein, das er sich einredete, indem er es schreibend heraufbeschwor, war groß: »Ich kenne mein Los, es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen. « Doch worin besteht Nietzsches Unge-heuerlichkeit, die ihn nach seinem Tod tatsächlich zum wohl einflussreichsten Philosophen des kommenden 20. Jahrhunderts machen sollte?
Nietzsches große Leistung liegt in seiner ebenso schonungs¬losen wie schwungvoll vorgetragenen Kritik. Leidenschaftli¬cher als alle anderen Philosophen zuvor hatte er vorgeführt, wie anmaßend und unwissend der Mensch die Welt, in der er lebt, nach der Logik und Wahrheit seiner Art beurteilt: der Lo¬gik der menschlichen Spezies. Die »klugen Tiere« glauben, dass sie einen exklusiven Status hätten. Nietzsche dagegen vertrat vehement die Auffassung, dass der Mensch tatsächlich ein Tier ist und dass auch sein Denken dadurch bestimmt wird: durch Triebe und Instinkte, durch seinen primitiven Willen und durch ein eingeschränktes Erkenntnisvermögen. Die meisten Philo¬sophen des Abendlandes hatten demnach Unrecht, als sie den Menschen als etwas ganz Besonderes betrachtet hatten, als eine Art Hochleistungscomputer der Selbsterkenntnis. Denn kann der Mensch tatsächlich sich selbst und die objektive Realität er¬kennen? Ist er überhaupt dazu fähig? Die meisten Philosophen hatten nicht daran gezweifelt. Und einige hatten sich noch nicht einmal diese Frage gestellt. Sie hatten ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass das menschliche Denken gleichzeitig so etwas war wie ein universelles Denken. Sie betrachteten den Men¬schen eben nicht als ein kluges Tier, sondern als ein Wesen auf einer ganz anderen Stufe. Systematisch hatten sie das Erbe aus dem Tierreich geleugnet, das ihnen bei der morgendlichen Rasur vor dem Spiegel ebenso unmissverständlich entgegengrinste wie später, nach Feierabend in den Daunen. Einer nach dem anderen hatten sie an einem großen Graben zwischen Mensch und Tier geschaufelt. Des Menschen Vernunft und Verstand, seine Denk-und Urteilsfähigkeit bildeten den allein selig machenden Ma߬stab, um die belebte Natur zu bewerten. Und sie verurteilten das »bloß« Körperliche als völlig zweitrangig.
Um sicher zu sein, dass sie mit ihren erlesenen Vorstellungen von sich selbst richtig lagen, mussten die Philosophen annehmen, dass Gott den Menschen mit einem vorzüglichen Erkenntnis¬apparat ausgestattet habe. Mit seiner Hilfe konnten sie im »Buch der Natur« die Wahrheit über die Welt lesen. Doch wenn es rich¬tig war, dass Gott tot war, dann konnte es auch mit diesem Ap¬parat nicht allzu weit her sein. Dann musste dieser Apparat ein Produkt der Natur sein, und wie alles in der Natur irgendwie un¬vollkommen. Genau diese Einsicht hatte Nietzsche schon bei Ar¬thur Schopenhauer gelesen: »Wir sind eben bloß zeitliche, end¬liche, vergängliche, traumartige, wie Schatten vorüber fliegende Wesen.« Und was sollte denen ein »Intellekt, der unendliche, ewige, absolute Verhältnisse fasste? « Das Erkenntnisvermögen des menschlichen Geistes, wie Schopenhauer und Nietzsche vor-ausahnten, steht in einer direkten Abhängigkeit zu den Erforder¬nissen der evolutionären Anpassung. Der Mensch vermag nur das zu erkennen, was der im Konkurrenzkampf der Evolution entstandene Erkenntnisapparat ihm an Erkenntnisfähigkeit ge¬stattet. Wie jedes andere Tier, so modelliert der Mensch sich die Welt danach, was seine Sinne und sein Bewusstsein ihm an Ein¬sichten erlauben. Denn eines ist klar: All unser Erkennen hängt zunächst einmal von unseren Sinnen ab. Was wir nicht hören, nicht sehen, nicht fühlen, nicht schmecken und nicht ertasten können, das nehmen wir auch nicht wahr, und es kommt in unse¬rer Welt nicht vor. Selbst die abstraktesten Dinge müssen wir als Zeichen lesen oder sehen können, um sie uns vorstellen zu kön¬nen. Für eine völlig objektive Weltsicht bräuchte der Mensch also einen wahrhaft übermenschlichen Sinnesapparat, der das ganze Spektrum möglicher Sinneswahrnehmungen ausschöpft: die Su¬peraugen des Adlers, den kilometerweiten Geruchssinn von Bä¬ren, das Seitenliniensystem der Fische, die seismographischen Fähigkeiten einer Schlange usw. Doch all das können Menschen nicht, und eine umfassende objektive Sicht der Dinge kann es deshalb auch nicht geben. Unsere Welt ist niemals die Welt, wie sie »an sich« ist, ebenso wenig wie jene von Hund und Katze, Vo¬gel oder Käfer. »Die Welt, mein Sohn«, erklärt im Aquarium der Vaterfisch seinem Filius, »ist ein großer Kasten voller Wasser!«
Nietzsches schonungsloser Blick auf die Philosophie und die Religion hatte gezeigt, wie überanstrengt die meisten Selbstdefi¬nitionen des Menschen sind. (Dass er selbst neue Überanstren¬gungen und Verspanntheiten in die Welt gesetzt hat, ist eine ganz andere Sache). Das menschliche Bewusstsein wurde nicht durch die drängende Frage ausgeformt: »Was ist Wahrheit? « Wichtiger war sicher die Frage: Was ist für mein Überleben und Fortkommen das Beste? Was dazu nichts beitrug, hatte wahr¬scheinlich eher wenige Chancen, in der Evolution des Menschen eine bedeutende Rolle zu spielen. Nietzsche hatte zwar die vage Hoffnung, dass vielleicht gerade diese Selbsterkenntnis den Menschen schlauer und möglicherweise zu einem »Übermen¬schen« machen könnte, der tatsächlich seinen Erkenntnissinn vergrößert. Aber auch hier ist Vorsicht sicher das bessere Rezept als Pathos. Denn auch alle Einsicht in das menschliche Bewusst¬sein und seine »Chemie«, die, wie wir noch sehen werden, seit Nietzsches Tagen enorme Fortschritte gemacht hat, selbst die ausgeklügeltsten Messapparaturen und sensibelsten Beobach¬tungen ändern nichts an der Tatsache, dass dem Menschen eine schlechthin objektive Erkenntnis verwehrt bleibt.
Aber ist das eigentlich so schlimm? Wäre es nicht vielleicht viel schlimmer, wenn der Mensch alles über sich selbst wüsste? Brau¬chen wir eine Wahrheit, die frei und unabhängig über unseren Häuptern schwebt, überhaupt? Manchmal ist der Weg auch ein schönes Ziel, vor allem wenn es ein so spannender Pfad ist wie die verschlungenen Wege, die zu uns selbst führen. »Wir haben nie nach uns gesucht - wie sollte es geschehen, dass wir uns ei-nes Tages *den? «, hatte Nietzsche in der Genealogie der Moral gefragt. Versuchen wir also, uns so weit, wie es uns gegenwärtig möglich ist, zu finden. Welchen Weg sollen wir nehmen? Welche Methode anwenden? Und wie könnte das aussehen, was man am Ende findet? Wenn all unsere Erkenntnis von unserem Wir¬beltiergehirn abhängt und sich darin abspielt, fangen wir doch am besten bei diesem Gehirn an. Und die erste Frage lautet: Wo kommt es her? Und warum ist es so beschaffen, wie es ist?
HADAR
Lucy in the Sky - Woher kommen wir?
Dies ist die Geschichte von drei Geschichten. Die erste lautet so: Am 28. Februar 1967 - die USA bombardierten Nordvietnam mit Napalmbomben und Agent Orange, in Berlin gab es die ersten Studentenproteste, die Kommune I richtete sich gerade ein, und Che Guevara begann seinen Guerillakampf im zentralbolivianischen Hochland, an diesem Tag also schlossen sich Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr in den Abbey Road Studios in London ein. Ergebnis ihrer Aufnahmen war das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, und einer der Songs darauf war Lucy in the Sky with Diamonds. Aufgrund des Titels (Lucy in the Sky with Diamonds) und des surrealen Textes glauben viele Beatles-Fans bis heute, John Lennon hätte das Lied während eines Trips geschrieben und die ganze bunte Traumwelt sei eine Hommage an LSD. Allein, die Wahrheit ist etwas schlichter und anrührender. Denn Lucy ist niemand anders als eine Klassenkameradin von Lennons Sohn Julian, die er seinem Vater auf einem selbst gezeichneten Bild gezeigt hatte, als eben »Lucy in the Sky with Diamonds«.
Und damit beginnt die zweite Geschichte. Donald Carl Johanson war noch keine 30, als er 1973 mit einer internationalen Forschergemeinschaft ins staubige und trockene Hochland Äthiopiens unweit der Stadt Hadar kam. Johanson hatte den Ruf, ein Experte für Schimpansenzähne zu sein, ein Image, das er eher als einen Fluch betrachtete. Schon seit drei Jahren saß er nun an seiner Doktorarbeit über die Zahnreihen der Schimpansen,
hatte alle europäischen Museen nach Menschenaffenschädeln durchforstet und hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Schimpansen-Zähne. Doch ein Mann mit seinen Kenntnissen war einigen seiner renommierteren französischen und amerikanischen Kollegen Gold wert. Wer nach menschlichen Fossilien suchte, der brauchte einen Experten für Zähne. Denn Zähne sind häufig die am besten erhaltenen Fundstücke, und Menschenzähne und Schimpansenzähne sind sich sehr ähnlich. Johanson selbst war froh, überhaupt dabei sein zu dürfen, denn eine wissenschaftliche Karriere war dem Sohn schwedischer Auswanderer aus Hartford in Connecticut nicht in die Wiege gelegt worden. Sein Vater starb, als Don gerade zwei Jahre alt war, und Johanson verbrachte eine Kindheit in ärmlichen Verhältnissen. Ein Anthropologe in der Nachbarschaft, der sich des kleinen Don als väterlicher Freund annahm, förderte ihn und weckte sein Interesse an der Ur- und Frühgeschichte. Johanson studierte tatsächlich Anthropologie und trat in die Fußstapfen seines Förderers. Er selbst sollte weitaus größere hinterlassen. Doch davon wusste der dunkelhaarige schlaksige junge Mann mit den langen Koteletten noch nichts, der in dem glühend heißen wüstenhaften Landstrich des so genannten Afar-Dreiecks im Camp nahe dem Awash-Fluss hockte und zwischen Steinen, Staub und Erde nach Überresten urzeitlicher Wesen suchte. Schon nach kurzer Zeit stolperte er über ein paar seltsame Knochen: den oberen Teil eines Schienbeins und den unteren Teil eines Oberschenkels. Beide passten perfekt zusammen. Johanson bestimmte die Knochen als das Knie eines kleinen, etwa 90 Zentimeter großen aufrecht gehenden Primaten, der vor mehr als drei Millionen Jahren gelebt haben musste. Eine Sensation! Denn dass menschenähnliche Wesen schon vor drei Millionen Jahren aufrecht gingen, war bis dahin weder bekannt noch erahnt. Wer würde ihm, dem jungen unbekannten Schimpansenzahn-Experten so etwas glauben? Er hatte nur eine Wahl: Er musste ein komplettes Skelett finden! Die Zeit lief ab, aber ein Jahr später kehrte Johanson ins Afar-Dreieck zurück. Am 24. November 1974 begleitete er den amerikanischen Studenten Tom Gray zu einer Fundstelle. Bevor er ins Camp zurückkehrte, machte er einen letzten Umweg. Dabei entdeckte er einen Armknochen im Geröll. Ringsum lagen noch mehr Knochen, Stücke einer Hand, Wirbel, Rippen, Schädelbruchstücke: die Teile eines urtümlichen Skeletts.
Und dies ist die Verbindung zu der dritten Geschichte - die Geschichte einer kleinen Frau, die in einer Gegend lebte, die dem heutigen Äthiopien entspricht. Sie ging aufrecht, und ihre Hand war zwar kleiner als die heutige Hand eines Erwachsenen, dennoch war sie ihr verblüffend ähnlich. Die Dame war ziemlich kleinwüchsig, aber ihre männlichen Verwandten waren möglicherweise bis zu 140 cm groß. Für ihre Größe war sie sehr kräftig. Sie hatte stabile Knochen, und ihre Arme waren ziemlich lang. Ihr Kopf glich dem eines Menschenaffen, nicht dem eines Menschen. Sie hatte einen stark vorgeschobenen Kiefer und eine flache Schädeldecke. Vermutlich war sie dunkel behaart, wie die anderen afrikanischen Menschenaffen, aber sicher weiß man das natürlich nicht. Es ist auch schwer zu sagen, wie schlau sie war. Ihr Gehirn hatte ziemlich genau die Größe eines Schimpansen-Gehirns, aber wer will sagen, was darin vor sich ging? Sie starb im Alter von 20 Jahren, ihre Todesursache ist unbekannt. 3,18 Millionen Jahre später ist »AL 288-1« das bei weitem älteste halbwegs vollständige Skelett eines menschenähnlichen Individuums, das bisher gefunden wurde. Die junge Dame gehörte zur Spezies Australopithecus afarensis. Australopithecus heißt »Südaffe«, und afarensis bezeichnet den Fundort im Afar-Dreieck.
Die beiden Forscher rasten mit ihrem Geländewagen zurück ins Camp. »Wir haben es«, schrie Gray schon von weitem, »mein Gott, wir haben es. Wir haben das ganze Ding! « Die Stimmung war euphorisch. »In der ersten Nacht nach der Entdeckung gingen wir nicht zu Bett. Wir redeten unaufhörlich und tranken ein Bier nach dem anderen«, wie Johanson sich erinnert. Sie lachten und tanzten. Und hier verknüpft sich die erste mit der zweiten und dritten Geschichte: Der Kassettenrecorder dröhnte in voller Lautstärke immer und immer wieder Lucy in the Sky with Diamonds in den äthiopischen Nachthimmel. Irgendwann war bei dem zu 40 Prozent vollständigen Skelett nur noch von »Lucy« die Rede. Und Lucy O'Donnell, Julian Lennons Klassenkameradin, konnte sich freuen. Das Patenkind ihres Namens wurde der wohl berühmteste Fund der gesamten Ur- und Frühgeschichte.
Don Johansons Lucy bewies, was schon zuvor als überaus wahrscheinlich galt: Die »Wiege der Menschheit« liegt in Afrika. Das Bild von der Stammesgeschichte als persönliche Entwicklungsgeschichte bewahrt den Schöpfungsmythos. Doch weniger bildreich weckt die Rede von der Wiege auch gleichfalls die Hoffnung, die Grenze von Tier und Mensch benennen zu können; nicht nur als Angabe des Ortes, sondern zugleich auch der Zeit, in der der Mensch aus der großen geologischen Vulva der ostafrikanischen Gregory-Spalte entstieg und sich aufrechten Ganges faustkeilbewehrt zum sprechenden Großwildjäger mauserte. Doch war das wirklich die gleiche Spezies, derselbe Mensch, der als erster und einziger Primat den aufrechten Gang wählte, Werkzeuge gebrauchte und damit auf Großwildjagd ging?
© 2007 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
»In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnen¬systemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der ›Weltgeschichte‹: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur er¬starrte das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben. - So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genü-gend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüch¬tig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt in¬nerhalb der Natur ausnimmt; es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm dreh¬ten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so wür¬den wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt.«
Der Mensch ist ein kluges Tier, das sich doch zugleich selbst völlig überschätzt. Denn sein Verstand ist nicht auf die große Wahrheit, sondern nur auf die kleinen Dinge im Leben ausge¬richtet. Kaum ein anderer Text in der Geschichte der Philoso¬phie hat auf so poetische wie schonungslose Weise dem Men¬schen den Spiegel vorgehalten. Geschrieben wurde dieser viel leicht schönste Anfang eines philosophischen Buches im Jahr 1873 unter dem Titel: Über Wahrheit und Lüge im außermora¬lischen Sinne. Und sein Verfasser war ein junger, gerade 29-jäh¬riger Professor für Altphilologie an der Universität Basel.
Doch Friedrich Nietzsche veröffentlichte seinen Text über die klugen und hochmütigen Tiere nicht. Soeben hatte er schwere Blessuren davongetragen, weil er ein Buch über die Grundlagen der griechischen Kultur geschrieben hatte. Seine Kritiker ent¬larvten es als unwissenschaftlich und als spekulativen Unsinn, was es wohl weitgehend auch ist. Von einem gescheiterten Wun¬derkind war die Rede, und sein Ruf als Altphilologe war ziem¬lich ruiniert.
Dabei hat alles so viel versprechend angefangen. Der kleine Fritz, 1844 im sächsischen Dorf Röcken geboren und aufge¬wachsen in Naumburg an der Saale, galt als ein hochbegabter und sehr gelehriger Schüler. Sein Vater war ein lutherischer Pfar¬rer, und auch die Mutter war sehr fromm. Als der Junge vier Jahre alt ist, stirbt der Vater und kurz darauf auch Nietzsches jüngerer Bruder. Die Familie zieht nach Naumburg, und Fritz wächst in einem reinen Frauenhaushalt auf. Auf der Knaben¬schule und später am Domgymnasium wird man auf sein Talent aufmerksam. Nietzsche besucht das angesehene Internat Schul¬pforta und schreibt sich 1864 an der Universität Bonn für klas¬sische Philologie ein. Das Theologiestudium, das er ebenfalls be¬ginnt, gibt er schon nach dem ersten Semester wieder auf. Zu gern hätte er der Mutter den Gefallen getan, ein rechter Pfarrer zu werden - allein ihm fehlt der Glaube. Der »kleine Pastor«, als der das fromme Pfarrerskind einst in Naumburg verspottet wurde, ist vom Glauben abgefallen. Die Mutter, das Pfarrhaus und der Glaube sind ein Gefängnis, aus dem er sich gesprengt hat, doch ein Leben lang wird dieser Wandel an ihm nagen. Nach einem Jahr wechselt Nietzsche mit seinem Professor nach Leip¬zig. Sein Ziehvater schätzt ihn so sehr, dass er ihn der Universität Basel als Professor empfiehlt. 1869 wird der 25-jährige außer ordentlicher Professor. Seine fehlenden Abschlüsse, Promotion und Habilitation, bekommt er kurzerhand von der Uni verlie¬hen. In der Schweiz lernt Nietzsche die Gelehrten und Künstler der Zeit kennen, darunter Richard Wagner und seine Frau Co¬sima, denen er zuvor bereits in Leipzig begegnet war. Nietzsches Begeisterung für Wagner ist so groß, dass er sich 1872 von des¬sen pathetischer Musik zu seinem nicht weniger pathetischen Fehlschlag über Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik verleiten lässt.
Nietzsches Buch war schnell abgetan. Der Gegensatz vom vermeintlich »Dionysischen« der Musik und dem vermeintlich »Apollinischen« der bildenden Kunst war schon seit der Früh-romantik bekannt und gemessen an der historischen Wahrheit eine wilde Spekulation. Außerdem beschäftigte sich die gelehrte Welt in Europa mit der Geburt einer viel wichtigeren Tragödie. Ein Jahr zuvor hat der studierte Theologe und renommierte eng¬lische Botaniker Charles Darwin sein Buch über die Abstam¬mung des Menschen aus dem Tierreich veröffentlicht. Obwohl der Gedanke, dass sich der Mensch aus primitiveren Vorformen entwickelt haben könnte, seit spätestens zwölf Jahren im Raum stand - Darwin selbst hat in seinem Buch über die Entstehung der Arten angekündigt, dass hieraus auch auf den Menschen »ein bezeichnendes Licht« fallen werde -, war das Buch ein Rei-ßer. In den 1860er Jahren hatten zahlreiche Naturforscher die gleiche Konsequenz gezogen und den Menschen ins Tierreich nahe dem gerade erst entdeckten Gorilla einsortiert. Die Kirche, vor allem in Deutschland, bekämpfte Darwin und seine Anhän¬ger noch bis zum Ersten Weltkrieg. Doch von Anfang an war klar, dass es nun kein freiwilliges Zurück zur früheren Weltsicht mehr geben konnte. Gott als persönlicher Urheber und Lenker des Menschen war tot. Und die Naturwissenschaften feierten ihren Siegeszug mit einem neuen sehr nüchternen Bild des Men¬schen: Das Interesse an Affen wurde größer als das an Gott. Und die erhabene Wahrheit vom Menschen als einer gottgleichen Kreatur zerfiel in zwei Teile: das unglaubwürdig gewor¬dene Erhabene und die schlichte Wahrheit vom Menschen als einem intelligenten Tier.
Nietzsches Begeisterung für diese neue Weltsicht ist groß. »Al¬les, was wir brauchen«, schreibt er später einmal, »ist eine Che¬mie der moralischen, religiösen, ästhetischen Vorstellungen und Empfindungen, ebenso wie all jener Regungen, welche wir im Groß- und Kleinverkehr der Kultur und Gesellschaft, ja in der Einsamkeit an uns erleben.« Genau an jener »Chemie« arbei¬ten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zahlreiche Wissen-schaftler und Philosophen: an einer biologischen Daseinslehre ohne Gott. Doch Nietzsche beteiligt sich selbst keinen Deut da¬ran. Die Frage, die ihn beschäftigt, ist eine ganz andere: Was bedeutet die nüchtern wissenschaftliche Sicht für das Selbstver¬ständnis des Menschen? Macht es den Menschen größer, oder macht es ihn kleiner? Hat er alles verloren, oder gewinnt er et¬was dazu, dadurch, dass er sich jetzt selbst klarer sieht? In die-ser Lage schrieb er den Aufsatz über Wahrheit und Lüge, seinen vielleicht schönsten Text.
Die Frage, ob der Mensch kleiner oder größer geworden war, beantwortete Nietzsche je nach Stimmung und Laune. Wenn es ihm schlecht ging - und es ging ihm oft schlecht -, war er ge¬drückt und zerknirscht und predigte ein Evangelium des Schmut¬zes. War er dagegen hochgestimmt, ergriff ihn ein stolzes Pathos und ließ ihn vom Übermenschen träumen. Seine hochfliegenden Phantasien und das donnernde Selbstbewusstsein seiner Bücher standen dabei in einem geradezu haarsträubenden Gegensatz zu seiner Erscheinung: ein kleiner, etwas dicklicher, weicher Mann. Ein trotziger Schnauzbart, eine richtige Bürste, sollte sein wei¬ches Gesicht aufmöbeln und männlicher machen, aber die vielen Krankheiten von Kindertagen an ließen ihn schwach erschei¬nen und sich schwach fühlen. Er war stark kurzsichtig, litt un¬ter Magenbeschwerden und schweren Migräneanfällen. Mit 35 fühlte er sich bereits als ein körperliches Wrack und beendete seine Lehrtätigkeit in Basel. Eine oft vermutete Syphilis-Infek¬tion, so scheint es, gab ihm später den Rest.
Im Sommer 1881, zwei Jahre nach seinem Abschied von der Universität, entdeckte Nietzsche eher zufällig sein ganz persön¬liches Paradies: den kleinen Ort Sils Maria im schweizerischen Oberengadin. Eine phantastische Landschaft, die ihn sofort be¬geisterte und inspirierte. Immer wieder fuhr er in den kommen¬den Jahren dorthin, unternahm lange einsame Spaziergänge und schmiedete neue pathetische Gedanken. Vieles davon brachte er im Winter in Rapallo und an der Mittelmeerküste, in Genua und in Nizza, zu Papier. Das meiste zeigt Nietzsche als einen klugen, literarisch anspruchsvollen und schonungslosen Kriti¬ker, der seine Finger in die Wunden der abendländischen Phi¬losophie legt. Was seine eigenen Vorschläge zu einer neuen Er¬kenntnistheorie und Moral anbelangt dagegen, begeistert er sich für einen unausgegorenen Sozialdarwinismus und flüchtet sich oft in schwiemeligen Kitsch. Je markiger seine Texte daherkom¬men, umso mehr sind sie mit großer Geste danebengegriffen. »Gott ist tot« - schreibt er das eine um das andere Mal -, aber das wissen die meisten seiner Zeitgenossen schon von Darwin und anderen.
1887, Nietzsche blickt das vorletzte Mal auf die schneebe¬deckten Gipfel von Sils Maria, entdeckt er das Thema von sei¬nen klugen Tieren aus dem alten Aufsatz wieder - das Problem von der begrenzten Erkenntnis aller Menschentiere. Seine Streit¬schrift Zur Genealogie der Moral beginnt mit den Worten: »Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst: Das hat seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht - wie sollte es geschehen, dass wir uns eines Tages fänden?« Wie so oft spricht er von sich selbst im Plural, wie von einer sehr spe¬ziellen Tierart, die er als Erster beschreibt: » Unser Schatz ist, wo die Bienenkörbe unsrer Erkenntnis stehn. Wir sind immer dazu unterwegs, als geborne Flügelthiere und Honigsammler des Geistes, wir kümmern uns von Herzen eigentlich nur um
Eins - Etwas >heimzubringen<. Viel Zeit dafür bleibt ihm nicht mehr. Zwei Jahre später erleidet Nietzsche in Turin einen Zu¬sammenbruch. Seine Mutter holt den 44-jährigen Sohn in Ita¬lien ab und bringt ihn nach Jena in eine Klinik. Später lebt er bei ihr, aber er bringt nichts mehr zu Papier. Acht Jahre darauf stirbt die Mutter, und der geistig schwer umnachtete Sohn kommt in die Wohnung seiner nicht sonderlich geliebten Schwester. Am 25 August 1900 stirbt Nietzsche in Weimar im Alter von 55 Jahren.
Nietzsches Selbstbewusstsein, das er sich einredete, indem er es schreibend heraufbeschwor, war groß: »Ich kenne mein Los, es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen. « Doch worin besteht Nietzsches Unge-heuerlichkeit, die ihn nach seinem Tod tatsächlich zum wohl einflussreichsten Philosophen des kommenden 20. Jahrhunderts machen sollte?
Nietzsches große Leistung liegt in seiner ebenso schonungs¬losen wie schwungvoll vorgetragenen Kritik. Leidenschaftli¬cher als alle anderen Philosophen zuvor hatte er vorgeführt, wie anmaßend und unwissend der Mensch die Welt, in der er lebt, nach der Logik und Wahrheit seiner Art beurteilt: der Lo¬gik der menschlichen Spezies. Die »klugen Tiere« glauben, dass sie einen exklusiven Status hätten. Nietzsche dagegen vertrat vehement die Auffassung, dass der Mensch tatsächlich ein Tier ist und dass auch sein Denken dadurch bestimmt wird: durch Triebe und Instinkte, durch seinen primitiven Willen und durch ein eingeschränktes Erkenntnisvermögen. Die meisten Philo¬sophen des Abendlandes hatten demnach Unrecht, als sie den Menschen als etwas ganz Besonderes betrachtet hatten, als eine Art Hochleistungscomputer der Selbsterkenntnis. Denn kann der Mensch tatsächlich sich selbst und die objektive Realität er¬kennen? Ist er überhaupt dazu fähig? Die meisten Philosophen hatten nicht daran gezweifelt. Und einige hatten sich noch nicht einmal diese Frage gestellt. Sie hatten ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass das menschliche Denken gleichzeitig so etwas war wie ein universelles Denken. Sie betrachteten den Men¬schen eben nicht als ein kluges Tier, sondern als ein Wesen auf einer ganz anderen Stufe. Systematisch hatten sie das Erbe aus dem Tierreich geleugnet, das ihnen bei der morgendlichen Rasur vor dem Spiegel ebenso unmissverständlich entgegengrinste wie später, nach Feierabend in den Daunen. Einer nach dem anderen hatten sie an einem großen Graben zwischen Mensch und Tier geschaufelt. Des Menschen Vernunft und Verstand, seine Denk-und Urteilsfähigkeit bildeten den allein selig machenden Ma߬stab, um die belebte Natur zu bewerten. Und sie verurteilten das »bloß« Körperliche als völlig zweitrangig.
Um sicher zu sein, dass sie mit ihren erlesenen Vorstellungen von sich selbst richtig lagen, mussten die Philosophen annehmen, dass Gott den Menschen mit einem vorzüglichen Erkenntnis¬apparat ausgestattet habe. Mit seiner Hilfe konnten sie im »Buch der Natur« die Wahrheit über die Welt lesen. Doch wenn es rich¬tig war, dass Gott tot war, dann konnte es auch mit diesem Ap¬parat nicht allzu weit her sein. Dann musste dieser Apparat ein Produkt der Natur sein, und wie alles in der Natur irgendwie un¬vollkommen. Genau diese Einsicht hatte Nietzsche schon bei Ar¬thur Schopenhauer gelesen: »Wir sind eben bloß zeitliche, end¬liche, vergängliche, traumartige, wie Schatten vorüber fliegende Wesen.« Und was sollte denen ein »Intellekt, der unendliche, ewige, absolute Verhältnisse fasste? « Das Erkenntnisvermögen des menschlichen Geistes, wie Schopenhauer und Nietzsche vor-ausahnten, steht in einer direkten Abhängigkeit zu den Erforder¬nissen der evolutionären Anpassung. Der Mensch vermag nur das zu erkennen, was der im Konkurrenzkampf der Evolution entstandene Erkenntnisapparat ihm an Erkenntnisfähigkeit ge¬stattet. Wie jedes andere Tier, so modelliert der Mensch sich die Welt danach, was seine Sinne und sein Bewusstsein ihm an Ein¬sichten erlauben. Denn eines ist klar: All unser Erkennen hängt zunächst einmal von unseren Sinnen ab. Was wir nicht hören, nicht sehen, nicht fühlen, nicht schmecken und nicht ertasten können, das nehmen wir auch nicht wahr, und es kommt in unse¬rer Welt nicht vor. Selbst die abstraktesten Dinge müssen wir als Zeichen lesen oder sehen können, um sie uns vorstellen zu kön¬nen. Für eine völlig objektive Weltsicht bräuchte der Mensch also einen wahrhaft übermenschlichen Sinnesapparat, der das ganze Spektrum möglicher Sinneswahrnehmungen ausschöpft: die Su¬peraugen des Adlers, den kilometerweiten Geruchssinn von Bä¬ren, das Seitenliniensystem der Fische, die seismographischen Fähigkeiten einer Schlange usw. Doch all das können Menschen nicht, und eine umfassende objektive Sicht der Dinge kann es deshalb auch nicht geben. Unsere Welt ist niemals die Welt, wie sie »an sich« ist, ebenso wenig wie jene von Hund und Katze, Vo¬gel oder Käfer. »Die Welt, mein Sohn«, erklärt im Aquarium der Vaterfisch seinem Filius, »ist ein großer Kasten voller Wasser!«
Nietzsches schonungsloser Blick auf die Philosophie und die Religion hatte gezeigt, wie überanstrengt die meisten Selbstdefi¬nitionen des Menschen sind. (Dass er selbst neue Überanstren¬gungen und Verspanntheiten in die Welt gesetzt hat, ist eine ganz andere Sache). Das menschliche Bewusstsein wurde nicht durch die drängende Frage ausgeformt: »Was ist Wahrheit? « Wichtiger war sicher die Frage: Was ist für mein Überleben und Fortkommen das Beste? Was dazu nichts beitrug, hatte wahr¬scheinlich eher wenige Chancen, in der Evolution des Menschen eine bedeutende Rolle zu spielen. Nietzsche hatte zwar die vage Hoffnung, dass vielleicht gerade diese Selbsterkenntnis den Menschen schlauer und möglicherweise zu einem »Übermen¬schen« machen könnte, der tatsächlich seinen Erkenntnissinn vergrößert. Aber auch hier ist Vorsicht sicher das bessere Rezept als Pathos. Denn auch alle Einsicht in das menschliche Bewusst¬sein und seine »Chemie«, die, wie wir noch sehen werden, seit Nietzsches Tagen enorme Fortschritte gemacht hat, selbst die ausgeklügeltsten Messapparaturen und sensibelsten Beobach¬tungen ändern nichts an der Tatsache, dass dem Menschen eine schlechthin objektive Erkenntnis verwehrt bleibt.
Aber ist das eigentlich so schlimm? Wäre es nicht vielleicht viel schlimmer, wenn der Mensch alles über sich selbst wüsste? Brau¬chen wir eine Wahrheit, die frei und unabhängig über unseren Häuptern schwebt, überhaupt? Manchmal ist der Weg auch ein schönes Ziel, vor allem wenn es ein so spannender Pfad ist wie die verschlungenen Wege, die zu uns selbst führen. »Wir haben nie nach uns gesucht - wie sollte es geschehen, dass wir uns ei-nes Tages *den? «, hatte Nietzsche in der Genealogie der Moral gefragt. Versuchen wir also, uns so weit, wie es uns gegenwärtig möglich ist, zu finden. Welchen Weg sollen wir nehmen? Welche Methode anwenden? Und wie könnte das aussehen, was man am Ende findet? Wenn all unsere Erkenntnis von unserem Wir¬beltiergehirn abhängt und sich darin abspielt, fangen wir doch am besten bei diesem Gehirn an. Und die erste Frage lautet: Wo kommt es her? Und warum ist es so beschaffen, wie es ist?
HADAR
Lucy in the Sky - Woher kommen wir?
Dies ist die Geschichte von drei Geschichten. Die erste lautet so: Am 28. Februar 1967 - die USA bombardierten Nordvietnam mit Napalmbomben und Agent Orange, in Berlin gab es die ersten Studentenproteste, die Kommune I richtete sich gerade ein, und Che Guevara begann seinen Guerillakampf im zentralbolivianischen Hochland, an diesem Tag also schlossen sich Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr in den Abbey Road Studios in London ein. Ergebnis ihrer Aufnahmen war das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, und einer der Songs darauf war Lucy in the Sky with Diamonds. Aufgrund des Titels (Lucy in the Sky with Diamonds) und des surrealen Textes glauben viele Beatles-Fans bis heute, John Lennon hätte das Lied während eines Trips geschrieben und die ganze bunte Traumwelt sei eine Hommage an LSD. Allein, die Wahrheit ist etwas schlichter und anrührender. Denn Lucy ist niemand anders als eine Klassenkameradin von Lennons Sohn Julian, die er seinem Vater auf einem selbst gezeichneten Bild gezeigt hatte, als eben »Lucy in the Sky with Diamonds«.
Und damit beginnt die zweite Geschichte. Donald Carl Johanson war noch keine 30, als er 1973 mit einer internationalen Forschergemeinschaft ins staubige und trockene Hochland Äthiopiens unweit der Stadt Hadar kam. Johanson hatte den Ruf, ein Experte für Schimpansenzähne zu sein, ein Image, das er eher als einen Fluch betrachtete. Schon seit drei Jahren saß er nun an seiner Doktorarbeit über die Zahnreihen der Schimpansen,
hatte alle europäischen Museen nach Menschenaffenschädeln durchforstet und hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Schimpansen-Zähne. Doch ein Mann mit seinen Kenntnissen war einigen seiner renommierteren französischen und amerikanischen Kollegen Gold wert. Wer nach menschlichen Fossilien suchte, der brauchte einen Experten für Zähne. Denn Zähne sind häufig die am besten erhaltenen Fundstücke, und Menschenzähne und Schimpansenzähne sind sich sehr ähnlich. Johanson selbst war froh, überhaupt dabei sein zu dürfen, denn eine wissenschaftliche Karriere war dem Sohn schwedischer Auswanderer aus Hartford in Connecticut nicht in die Wiege gelegt worden. Sein Vater starb, als Don gerade zwei Jahre alt war, und Johanson verbrachte eine Kindheit in ärmlichen Verhältnissen. Ein Anthropologe in der Nachbarschaft, der sich des kleinen Don als väterlicher Freund annahm, förderte ihn und weckte sein Interesse an der Ur- und Frühgeschichte. Johanson studierte tatsächlich Anthropologie und trat in die Fußstapfen seines Förderers. Er selbst sollte weitaus größere hinterlassen. Doch davon wusste der dunkelhaarige schlaksige junge Mann mit den langen Koteletten noch nichts, der in dem glühend heißen wüstenhaften Landstrich des so genannten Afar-Dreiecks im Camp nahe dem Awash-Fluss hockte und zwischen Steinen, Staub und Erde nach Überresten urzeitlicher Wesen suchte. Schon nach kurzer Zeit stolperte er über ein paar seltsame Knochen: den oberen Teil eines Schienbeins und den unteren Teil eines Oberschenkels. Beide passten perfekt zusammen. Johanson bestimmte die Knochen als das Knie eines kleinen, etwa 90 Zentimeter großen aufrecht gehenden Primaten, der vor mehr als drei Millionen Jahren gelebt haben musste. Eine Sensation! Denn dass menschenähnliche Wesen schon vor drei Millionen Jahren aufrecht gingen, war bis dahin weder bekannt noch erahnt. Wer würde ihm, dem jungen unbekannten Schimpansenzahn-Experten so etwas glauben? Er hatte nur eine Wahl: Er musste ein komplettes Skelett finden! Die Zeit lief ab, aber ein Jahr später kehrte Johanson ins Afar-Dreieck zurück. Am 24. November 1974 begleitete er den amerikanischen Studenten Tom Gray zu einer Fundstelle. Bevor er ins Camp zurückkehrte, machte er einen letzten Umweg. Dabei entdeckte er einen Armknochen im Geröll. Ringsum lagen noch mehr Knochen, Stücke einer Hand, Wirbel, Rippen, Schädelbruchstücke: die Teile eines urtümlichen Skeletts.
Und dies ist die Verbindung zu der dritten Geschichte - die Geschichte einer kleinen Frau, die in einer Gegend lebte, die dem heutigen Äthiopien entspricht. Sie ging aufrecht, und ihre Hand war zwar kleiner als die heutige Hand eines Erwachsenen, dennoch war sie ihr verblüffend ähnlich. Die Dame war ziemlich kleinwüchsig, aber ihre männlichen Verwandten waren möglicherweise bis zu 140 cm groß. Für ihre Größe war sie sehr kräftig. Sie hatte stabile Knochen, und ihre Arme waren ziemlich lang. Ihr Kopf glich dem eines Menschenaffen, nicht dem eines Menschen. Sie hatte einen stark vorgeschobenen Kiefer und eine flache Schädeldecke. Vermutlich war sie dunkel behaart, wie die anderen afrikanischen Menschenaffen, aber sicher weiß man das natürlich nicht. Es ist auch schwer zu sagen, wie schlau sie war. Ihr Gehirn hatte ziemlich genau die Größe eines Schimpansen-Gehirns, aber wer will sagen, was darin vor sich ging? Sie starb im Alter von 20 Jahren, ihre Todesursache ist unbekannt. 3,18 Millionen Jahre später ist »AL 288-1« das bei weitem älteste halbwegs vollständige Skelett eines menschenähnlichen Individuums, das bisher gefunden wurde. Die junge Dame gehörte zur Spezies Australopithecus afarensis. Australopithecus heißt »Südaffe«, und afarensis bezeichnet den Fundort im Afar-Dreieck.
Die beiden Forscher rasten mit ihrem Geländewagen zurück ins Camp. »Wir haben es«, schrie Gray schon von weitem, »mein Gott, wir haben es. Wir haben das ganze Ding! « Die Stimmung war euphorisch. »In der ersten Nacht nach der Entdeckung gingen wir nicht zu Bett. Wir redeten unaufhörlich und tranken ein Bier nach dem anderen«, wie Johanson sich erinnert. Sie lachten und tanzten. Und hier verknüpft sich die erste mit der zweiten und dritten Geschichte: Der Kassettenrecorder dröhnte in voller Lautstärke immer und immer wieder Lucy in the Sky with Diamonds in den äthiopischen Nachthimmel. Irgendwann war bei dem zu 40 Prozent vollständigen Skelett nur noch von »Lucy« die Rede. Und Lucy O'Donnell, Julian Lennons Klassenkameradin, konnte sich freuen. Das Patenkind ihres Namens wurde der wohl berühmteste Fund der gesamten Ur- und Frühgeschichte.
Don Johansons Lucy bewies, was schon zuvor als überaus wahrscheinlich galt: Die »Wiege der Menschheit« liegt in Afrika. Das Bild von der Stammesgeschichte als persönliche Entwicklungsgeschichte bewahrt den Schöpfungsmythos. Doch weniger bildreich weckt die Rede von der Wiege auch gleichfalls die Hoffnung, die Grenze von Tier und Mensch benennen zu können; nicht nur als Angabe des Ortes, sondern zugleich auch der Zeit, in der der Mensch aus der großen geologischen Vulva der ostafrikanischen Gregory-Spalte entstieg und sich aufrechten Ganges faustkeilbewehrt zum sprechenden Großwildjäger mauserte. Doch war das wirklich die gleiche Spezies, derselbe Mensch, der als erster und einziger Primat den aufrechten Gang wählte, Werkzeuge gebrauchte und damit auf Großwildjagd ging?
© 2007 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
... weniger
Autoren-Porträt von Richard David Precht
Richard David Precht, geboren 1964, ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Seit seinem sensationellen Erfolg mit »Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?« waren alle seine Bücher zu philosophischen oder gesellschaftspolitischen Themen große Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophiesendung »Precht« im ZDF und diskutiert zusammen mit Markus Lanz im Nr.1-Podcast »LANZ & PRECHT« im wöchentlichen Rhythmus gesellschaftliche, politische und philosophische Entwicklungen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Richard David Precht
- 2012, 397 Seiten, Taschenbuch, Deutsch
- Verlag: Goldmann
- ISBN-10: 3442155282
- ISBN-13: 9783442155286
- Erscheinungsdatum: 11.09.2012
Kommentare zu "Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?"
0 Gebrauchte Artikel zu „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|



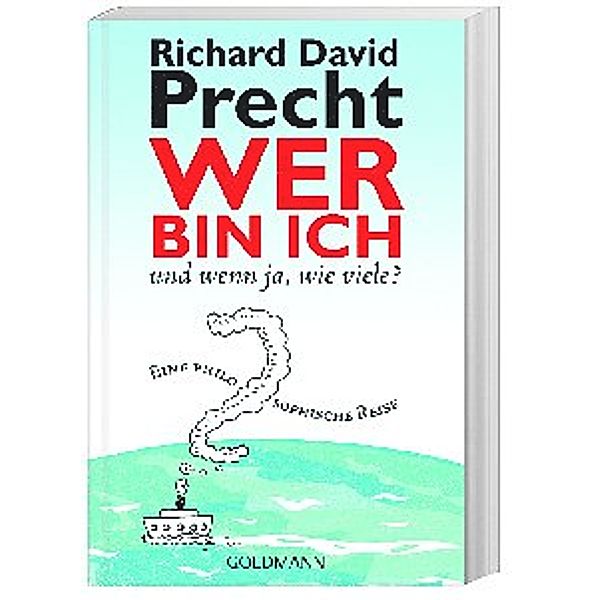

4 von 5 Sternen
5 Sterne 11Schreiben Sie einen Kommentar zu "Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?".
Kommentar verfassen